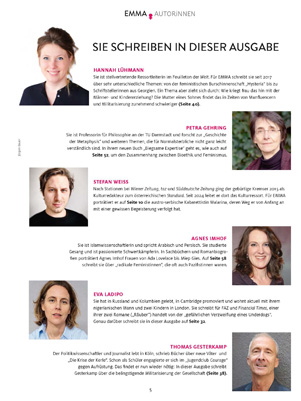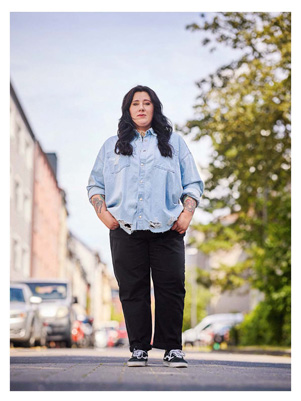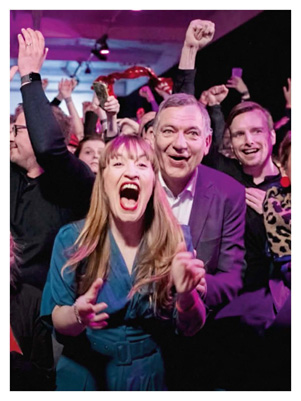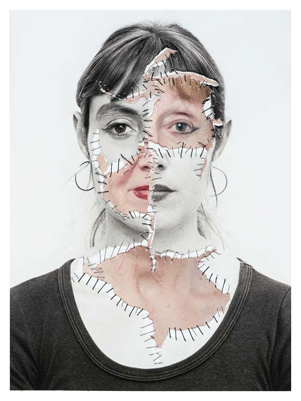Der Lillifee-Komplex
Vielleicht ist ja am Ende die Kartoffel schuld an der ganzen Geschmacksverirrung meiner Tochter. Wo die Kartoffel doch schon am Materialismus der Kleinen schuld ist, das behauptet zumindest Rudolf Steiner: Die Kartoffel wirkt durch die Erdgerichtetheit ihrer Keimblätter sehr stark auf das Nervensystem, schwächt damit das meditativ-verinnerlichende Denken und stärkt den reflektierenden Verstand. Darin sieht Steiner den Beweis, dass durch die Kartoffel ein auf das Materialistische reduziertes Vorstellungsleben gefördert wird. Vielleicht, fragt man sich als ratloser Vater inmitten eines Lillifee-Zimmers, vielleicht sollten wir mal versuchen, unserer Tochter die Kartoffeln zu verbieten? Wenn sonst schon nichts hilft.
Lillifee ist nämlich eindeutig eine Ausgeburt des Materialismus und der oberflächlichen Sinneswahrnehmung. Ach was, Lillifee ist das Raffinierteste und Hinterhältigste, was die Industrie in den vergangenen Jahren ersonnen hat, um kleine Mädchen zu Konsumgören zu deformieren. Man kann als Eltern noch so nachhaltig, vollwertig, konsumkritisch leben, reden, schenken, die Tochter will: Lillifee. Lillifee und dazu am besten all die Lillifee-Produkte, die jeder Spielzeugladen heute auf mindestens einem gesamten Stockwerk führt. Oder haben sich fünfjährige Mädchen vor zwanzig Jahren auch rosa Lipgloss zum Geburtstag gewünscht?
Für alle, die keine Töchter zwischen zwei und acht Jahren haben: Lillifee ist ein anorektisches Wesen mit Glitzerflügeln, Kussmündchen und blonden Wuschelhaaren, das in einem „Blütenschloss im Zaubergarten des Zauberlandes Pinkoviana“ lebt, einem Paradies ohne Konflikte. Lillifee trägt rosa Ballerinas, lächelt immer und ist von klinisch reiner Niedlichkeit. Sie hat keine Ideen, hat noch nie einen witzigen Satz gesagt und besitzt auch nicht ansatzweise so etwas wie einen eigenen Charakter.
Erschaffen wurde das Wesen 2004, also erst vor sechs Jahren, es hat sich seither aber schneller über das Land verbreitet als die Schweinegrippe oder Ebola. Monika Finsterbusch, die Frau, die Lillifee erfunden hat, war zuvor Modedesignerin und hat Plüschtiere entworfen. In Interviews sagt sie, sie habe mit Lillifee etwas „positiv Mädchenhaftes“ entwerfen wollen. Alltag, Schule, Eltern, Konflikte, all das interessiere sie nicht, wichtig sei, „die Kinder in eine Traumwelt zu entführen“.
Diese Traumwelt freilich ist voll gerümpelt mit mehr als dreihundert Lillifee-Produkten, die die Firma Coppenrath mittlerweile im Angebot hat. All diese Produkte sind in ein und demselben milchig-milden Rosaton gehalten: Glitzertattoos, Beauty-Sets, Bademäntel, Fahrradsattelschutz, Tapeten, Butterbrotdose, Zahnbürsten, Trinkflaschen, Noppenkondome, Handfeuerwaffen und Giftgasmasken. Pardon, die letzten drei Produkte gibt es natürlich nicht im Sortiment, besser gesagt: noch nicht. Shampoo aber schon, das selbstverständlich ph-hautneutral und alkaliseifenfrei ist und nicht einfach Shampoo, sondern Anti-Ziep-Shampoo heißt. Man kauft es am besten zusammen mit dem rosa Schaumbad „Feenstaub“, das „kleine Glitterpartikelchen“ enthält, was mich daran erinnert, dass ich unseren Kindern kürzlich ein polnisches Märchen vorlas, in dem drei Söhne ausziehen, um das Glück zu suchen. Danach fragte ich: „Was ist denn für euch beide das Glück?“ Unser Sohn sagte: „Meine Hasen und die Marionetten.“ Unsere Tochter sagte: „Rosa mit so ein bisschen Glitzer drin.“ Wow, dachte ich, ihr schäbigen Industriemogule, da habt ihr ganze Arbeit geleistet, wenn eine Fünfjährige das Glück mit der Lillifee-Ästhetik gleichsetzt.
Nun hat die Lillifee-Industrie das Rosa wahrlich nicht erfunden. In den Spielzeugläden von Toys’r’us sind die Gänge mit Mädchenspielzeug durchgehend rosa, abgesehen von vereinzelten Farbtupfern in Mintgrün, Lila und Orange. Fragt man Verkäufer, woran es liegt, dass Mädchen derart auf Rosa abfahren, sagen sie achselzuckend, das sei so stark in den Mädchen drin, das müsse genetisch bedingt sein.
Für diese These spricht, dass die für Roterkennung zuständigen Gene auf dem weiblichen X-Chromosom gelagert sind. Man könnte daraus schließen, dass dieses Chromosom bei kleinen Mädchen eben noch nicht ausgewachsen ist, dass Rosa also eine Art Schrumpfform von Rot darstellt. Gegen die These spricht allerdings die Tatsache, dass Rosa noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Jungenfarbe galt: Als die belgische Prinzessin Astrid 1927 ein Mädchen zur Welt brachte, schrieb das amerikanische Magazin Time, die Mutter sei nun sicher enttäuscht, schließlich sei die Wiege in Erwartung eines Stammhalters „in der Jungenfarbe“ dekoriert worden – in Rosa. Die Mädchenfarbe war damals Blau, schließlich war das in der Kunstgeschichte von jeher die Farbe der Jungfrau Maria gewesen. Das amerikanische Ladies’ Home Journal begründete die Zuordnung 1918 damit, Pink sei nun mal die „kräftigere und damit für Jungen geeignete Farbe“. Der Siegeszug des weiblichen Rosa begann erst nach dem Zweiten Weltkrieg.
Psychologisch gesehen, steht Rosa für Schutz und Sanftheit. Es ist erwiesen, dass Säuglinge in rosafarbenen Wänden weniger weinen als etwa in hellgelben. Bei Erwachsenen scheint das ähnlich zu sein: Im Schweizer Untersuchungsgefängnis Pfäffikon gibt es eine Zelle, die ganz in Rosa gehalten ist. In diese Zelle kommen Insassen mit einem hohen Maß an Gewaltbereitschaft.
Nach spätestens einem Tag sind die Häftlinge farbsediert. Der amerikanische Naturwissenschaftler Alexander Schauss stellte bereits in den 1970er Jahren fest, dass die Farbe Pink eine beruhigende Wirkung auf aggressive Häftlinge habe. Auf kleine Mädchen aber scheint Rosa anders zu wirken: Ich habe jedenfalls nicht den Eindruck, dass das Spielen mit Lillifee unsere Tochter zu einem friedlichen Wesen macht. Im Gegenteil, es erzeugt Unzufriedenheit, weil sie immer noch mehr von dem Prinzessinnenzeugs haben will.
Gundel Mattenklott erwähnt in „Zauberkreide“, ihrem historischen Überblick über die Kinder- und Jugendbuchliteratur zwischen 1945 und 1989, kein einziges Buch, das eine Prinzessin im Titel hätte. Heute bietet der Loewe-Verlag „Prinzessin Rosalea“, Ravensburger hat „Meine kleine Prinzessin“ im Angebot und Tessloff den Ratgeber „Wie werde ich Prinzessin in nur sieben Tagen“.
Und ganz vorneweg ist Lillifee, in der gleich zwei Kleinmädchenträume miteinander geklont wurden – der von der Prinzessin, der man alle Wünsche erfüllt, und der von der Zauberfee. All diese Prinzessinnen haben zweierlei gemeinsam: Zum einen sind sie keine sozialen Wesen, sondern gleichen eher autistischen Einzelkindern, die um sich selbst und ihre Wünsche kreisen. Im Lillifee-Film besitzt die Prinzessin einen befliegbaren Kleiderschrank von der Größe einer Turnhalle. Damit einhergehend sind sie alle als Prinzessinnen verkleidete Kampfdrohnen der Spielzeugindustrie. Sie alle dienen nur dazu, möglichst viel Merchandising-Zeugs an den Mann, das heißt, an die kleinen Mädchen zu bringen. Etwa die Hälfte seines Umsatzes von 70 Millionen Euro macht der Coppenrath-Verlag mit den so genannten Non-Book-Artikeln.
Es gibt auch so genannte Lillifee-Bücher, die angeblich darin erzählten Geschichten sind aber keine. Nach der Handlung dieser Bücher zu fragen, führt zu nichts, man kann ja auch nicht fragen, was die Handlung eines Bildschirmschoners ist. Die Bücher sind einfach nur hübsch anzuschauen. Eine Handlung setzt innere Veränderung voraus. Lillifee aber bleibt die, die sie von Anfang an war – eine sterile, keimfreie Projektionsfläche, um die herum Waren drapiert werden.
Immer wenn ich derart vor mich hin schimpfe, sagt meine Frau, sie habe früher auch tagelang ihre Barbies frisiert und die seien ja wohl sexistischer gewesen als dieses kleine Feenwesen. Genau das aber ist der Punkt, den ich so perfide finde: Barbie ist eine junge Frau, klar, mit einem Körper, der jedem Orthopäden Albträume bereiten muss. Als Frau wäre sie 2,26 Meter groß und nicht überlebensfähig. Doch Barbie nimmt – stellvertretend für die Mädchen – das Erwachsensein vorweg; die Mädchen versuchen aber nicht, ihren Lifestyle zu kopieren.
Lillifee hingegen ist ein Kind und holt die Konsumwelt der Erwachsenen mitten ins Kinderzimmer. Im Coppenrath-Katalog sieht man ein sechsjähriges Mädchen im Lillifee-Bademantel in den Lillifee-Spiegel schauen und ihre aufgeworfenen Lippen betrachten.
Die Frage ist, wie man als Eltern mit einer derartigen Geschmacksverirrung des eigenen Kindes umgehen soll. Verbieten? Oder soll man gar, wie die britischen Zwillingsschwestern und Mütter Emma und Abi Moore mit ihrer Kampagne „Pink stinks“, einen Feldzug gegen das omnipräsente Kinderzimmerrosa anzetteln? Und damit Gefahr laufen, dass dieser unterdrückte Wunsch irgendwann wie ein verdrängtes Trauma machtvoll zurückkehrt?
Nichts Schlimmeres als diese Eltern, die sagen, ihr Kind habe ja mittlerweile auch eingesehen, wie scheußlich Rosa ist, gell, Melanie? Und Melanie steht bedröppelt daneben und nickt mit dem Kopf. Man würde dann als Eltern denselben Fehler machen wie die Feministinnen der 1970er Jahre: Die US-Professorin Jo Paoletti behauptet in ihrem Buch „Pink and Blue – Telling the Boys from the Girls“, Rosa sei erst durch die Emanzipationsbewegung eindeutig weiblich besetzt worden. Gerade durch das vehemente Schimpfen auf alle Pinktöne hätte auch der Letzte die geschlechtliche Zuordnung verinnerlicht. Vielleicht lässt man die rosa Periode also einfach über sich hinwegziehen und hofft darauf, dass sie sich im Laufe der Zeit schon auswachsen wird.