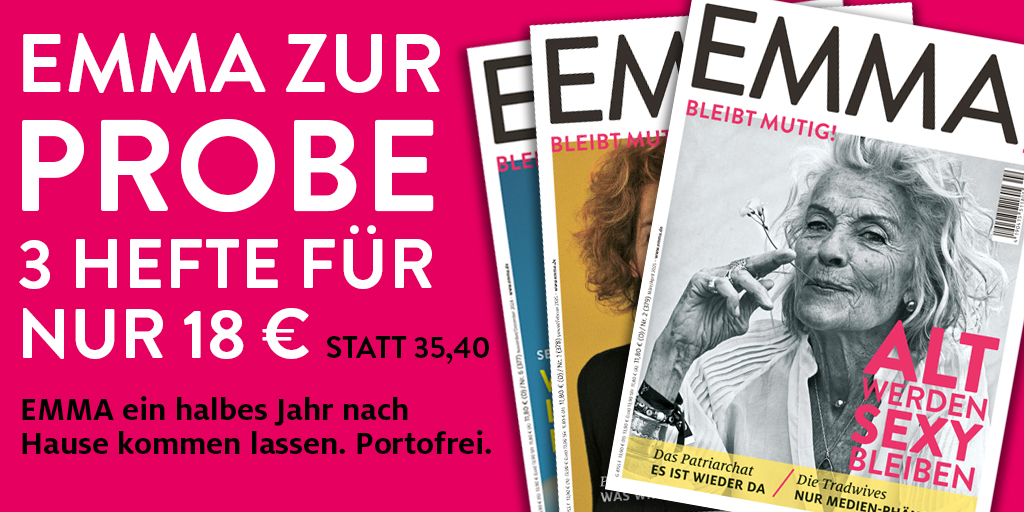"Die Klitoris ist das Lustorgan!"
Frau Prof. Mangler, Sie haben dafür gesorgt, dass die Klitoris jetzt auf OP-Aufklärungsbögen eingezeichnet ist.
Genau, die kam vorher einfach nicht vor. Beziehungsweise nur als kleiner Strich an den Vulvalippen. Alle Kliniken in Deutschland benutzen diese juristisch geprüften Aufklärungsbögen. Und dann sitzt man mit seinen Patientinnen da und schämt sich für diese Bögen. Ich habe die Klitoris zuerst immer selber eingezeichnet, habe dann aber den Verlag angeschrieben. In der Redaktion saßen zahlreiche kluge Frauen, die das Problem sofort verstanden haben. Die zuständigen Fachpersonen wollten jedoch eher keine Änderung.
Warum?
Die Gynäkologin war der Ansicht, das sei zu kompliziert, die Frauen würden das nicht verstehen. Wir haben viel diskutiert und schließlich konnten wir uns einigen, die Klitoris dann doch aufzunehmen. Dazu konnte ich eine Zeichnung zur Verfügung stellen. Seitdem bilden die Bögen die komplette Klitoris ab. Das finde ich richtig stark und eine sehr gute Entscheidung. Im Sinne der Aufklärung der Patientin. Und auch als Information für Ärztinnen und Ärzte, die an der Vulva oder im Unterleib operieren und denen die komplette Anatomie der Klitoris nicht geläufig ist.
Im Ernst?
Doch. Die Klitoris ist in den Anatomie-Büchern nicht abgebildet. Die Menschen, von denen ich Medizin gelernt habe, wussten auch nichts darüber. Ich habe mir dieses Wissen selbst erarbeitet. In meinen Anatomiebüchern stand es nicht.
Wie kann das sein? Es gibt ja inzwischen die Klitoris mit Schwellkörpern zum Selberausdrucken und sogar Klitoris-Schmuck.
Es gibt auch Anatomiebücher von 1844, die die Schwellkörper der Klitoris zeigen. Das Wissen ist also eigentlich schon lange vorhanden. In einer Welt, in der das weibliche Orgasmusorgan eine untergeordnete Rolle spielt, ist es das eine, die Anatomie nicht zu kennen, und das andere, außerdem auch die Funktionalität zu ignorieren. Also auszublenden, dass die Klitoris das Orgasmus-Organ der Frau ist. Vielleicht ist das Bedrohliche für manche: Dass der Penis und seine Relevanz infrage gestellt wird, weil es nicht um Penetration geht, sondern die Klitoris das Zielorgan ist. Das macht manche fertig!

Die OP-Bögen haben Sie revolutioniert. Was sollte in Schulbüchern anders dargestellt werden?
Ich schlage häufig die Schulbücher meiner Kinder auf, und auch ihre Kinderbücher. Und dann sehe ich da männliche nackte Menschen, bei denen steht „Penis“. Und weibliche nackte Menschen, bei denen steht „Scheide“. Da wird gleich ins Gehirn der Kinder reingehämmert: Der Penis und die Scheide bilden ein Paar. Das ist aber wieder ein sehr männlicher Blick auf die weibliche Sexualität. Denn die Vagina ist nicht unser Lustorgan. Sie ist aus der Perspektive von Frauen ein sehr langweiliges Organ. Da soll das Kind durch, weshalb die Evolution die Vagina sehr unsensibel gemacht hat, damit das bei der Geburt nicht so weh tut. Deshalb ist Penetration für die allermeisten Frauen nicht das, was ihnen große Lust macht. Da werden die Vulva und die Klitoris regelrecht geghostet und das falsche Pärchen „Penis und Vagina“ gebildet. Wenn wir aber überhaupt ein Pärchen bilden, müssten wir „Penis und Klitoris“ sagen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schonmal ein Schulbuch gesehen habe, in dem die Klitoris abgebildet war.
Von der Klitoris zu den Schamhaaren. Viele Frauen rasieren sie sich heutzutage ab, beeinflusst von der Pornoindustrie. Dabei haben die Schamhaare, wie Sie schreiben, eine wichtige Funktion.
Genau, sie sind zum einen Duftspeicher, bieten aber vor allem Schutz vor Bakterien. Sie funktionieren ein bisschen wie die Augenbrauen. Wenn Schweiß die Stirn herunterläuft, verfangen sich Fremdkörper und Bakterien in den Brauen und laufen nicht in die Augen, sondern an der Seite runter. Und so verfangen sich in den Vulvahaaren eben auch Bakterien und alle anderen Dinge, die da nicht hingehören. Die sind eine Art natürliche Blockade, bevor die Vulva erreicht wird. Deshalb kann es auch sinnvoll sein, die Vulvahaare zu lassen. Die Entfernung ist natürlich nicht lebensbedrohlich, weil wir im Vergleich zu unseren frühen Vorfahren relativ reinlich leben. Aber sie haben schon einen Nutzen. Ansonsten hätte es die Evolution nicht geschafft, sämtliche Körperhaare zu eliminieren, aber eben die Vulvahaare nicht. Abgesehen davon, dass beim Rasieren Mikroverletzungen entstehen, die auch nicht so prickelnd sind.
Sie sagen nicht „Schamhaare“?
Ich plädiere dafür, das Wort „Scham“ zu streichen und verwende stattdessen das Wort „Vulvahaare“ und „Vulvalippen“. Auch das Wort „Brustwarze“ finde ich nicht passend, weil eine Warze eine von Viren hervorgerufene krankhafte Veränderung der Haut ist. Ich habe aber noch keinen guten alternativen Begriff gefunden. Ich sage Mamille, das ist der medizinische Fachausdruck. Oder Nippel, aber das ist auch nicht ideal.
Sie betreiben den Podcast „Gyncast“. Zu welchen Themen haben Mädchen und Frauen besonders viele Fragen?
Es gibt eigentlich bei allen Themen Aufklärungsbedarf, aber vor allem bei Sexualität und Klitoris und Verhütung: Wie kann ich selber gut verhüten und wie könnte eine geschlechtergerechte Verhütung aussehen? Schwangerschaft und Geburt sind auch ein Riesenthema, und natürlich die Wechseljahre. Und dann auch Endometriose und PCO-Syndrom, einer Stoffwechselstörung, weil es zu beidem nicht viele Informationen gibt.
2001 ist der erste deutsche Frauengesundheitsbericht erschienen und stellte fest: Ausgerechnet die Gynäkologie spielte bisher „in der Gesundheitsberichterstattung kaum eine Rolle“. Knapp ein Vierteljahrhundert später erklären Sie: Die Gynäkologie ist eigentlich immer noch patriarchal geprägt und es fehlt immer noch Forschung. Wo zum Beispiel?
Bei den Themen Menopause, Endometriose oder dem PCO-Syndrom, geschlechtergerechte Verhütung und Sexualität. Da gibt es überall noch blinde Stellen. Bei den Wechseljahren zum Beispiel haben wir viele Studien zur Hormonersatztherapie. Trotzdem gibt es immer noch einen Haufen Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Zum Beispiel: Was sind bei einer Frau in den mittleren Jahren überhaupt Wechseljahrs-Symptome? Und was ist ein Alterungsprozess oder hat eine biografische Ursache? Und welche Frauen profitieren von einer Hormon-Ersatztherapie? Und da ist die Antwort: Wir brauchen eine individualisierte Herangehensweise und die haben wir ganz oft nicht.
Stichwort Hormonersatztherapie: Es werden Frauen ja standardmäßig nur Östrogen und Progesteron verschrieben. Dass die Eierstöcke auch Testosteron produzieren, das ja auch bei Frauen wichtig für die Lust ist, ist aber kein Thema.
Genau. Ich habe noch heute Morgen versucht, eine Übersicht zu erstellen über den Hormonstatus einer 30-Jährigen, einer 50-Jährigen und einer 70-Jährigen. Es müsste eigentlich sofort ersichtlich sein, wie es mit dem Testosteron in diesen Altersgruppen aussieht, auch, um die Frage beantworten zu können: Braucht eine 50-Jährige, der beide Eierstöcke entfernt wurden, eigentlich auch Testosteron, weil das ja auch in den Eierstöcken produziert wird? Die Frage ist: Warum wissen wir das alles nicht? Wir wissen es nicht, weil wir finanziell zu wenig in Frauengesundheit investieren. Zum Beispiel wurde in die Erforschung der Endometriose lange Zeit viel zu wenig Geld investiert.
Aber das hat sich doch jetzt verbessert.
Jetzt werden in Deutschland fünf Millionen in die Erforschung von Endometriose gesteckt. Das reicht für ein, zwei gute Forschungsprojekte, aber mehr auch nicht. Noch dramatischer ist es, wenn man sich Studien anschaut, die Männer und Frauen betreffen. Da wird oft nur die männliche Perspektive untersucht.
Wie kann das immer noch sein?
Das ist zum Beispiel beim Thema Herzinfarkt oder bei internistischen Erkrankungen der Fall. Oder ganz eklatant war es bei den Studien zu den Corona-Impfungen. Typisch weibliche Fragestellungen kamen da gar nicht vor. Zum Beispiel: Wie wirkt sich die Impfung auf den Zyklus aus? Das tut sie nämlich. Die Leute, die die Studien konzipiert haben, hatten den weiblichen Körper einfach gar nicht auf dem Schirm. Das ist aber nur ein Beispiel von vielen. Frauen sterben dreimal häufiger an einem Herzinfarkt. Frauen werden seltener reanimiert. Die ganze Medizin hat immer noch einen patriarchalen Blick. Sie ist immer noch von Männern für Männer gemacht. Und da fehlt dann zum Teil die Perspektive der Zielgruppe.
Aber inzwischen sind drei von vier Gynäkologen weiblich.
Ja, wir sind 77 Prozent Gynäkologinnen. Und ich glaube, die Mehrheit der praktizierenden Gynäkologinnen und auch der Gynäkologen ist durchaus progressiv und oft sogar feministisch. Diejenigen, die die Macht haben, also die, die über Forschung und Leitlinien entscheiden, sind es weniger. 87 Prozent der Lehrstuhlinhaber sind immer noch Männer. Unserem Berufsverband hat noch nie eine Frau vorgestanden und unsere Fachzeitschrift heißt immer noch Frauenarzt.
Wächst sich das nicht aus?
Kürzlich hat mir ein 63-jähriger Ordinarius gesagt: „Jetzt lassen Sie uns doch! Wir sterben doch sowieso aus und dann seid ihr nur noch Frauen!“ Vielleicht stimmt das, sie werden früher oder später emeritieren. Aber wir wollen die Strukturen verbessern. Es geht nicht gegen Männer, sondern für eine Strukturverbesserung. Die Strukturen in der Medizin sind für Frauen einfach nicht so passend, selbst wenn sie keine Kinder haben. Studien zeigen, dass Frauen gern partizipativer arbeiten, nicht so direktiv, lieber in Gruppen und ganzheitlich. Und wenn sie Kinder haben, gehen sie lieber selbstbestimmter in die Selbständigkeit oder angestellt in die Praxis und nicht in das Ordinariat an der Universität. Auch diese Strukturen sind von Männern für Männer gemacht.
Sie selbst leiten zwei Kliniken und haben fünf Kinder. Wie machen Sie das?
Das geht für mich nur in einem sehr durchstrukturierten Gesamtkonstrukt mit viel Hilfe meiner Familie, z. B. meiner Mutter. Auch versuche ich Zeit sehr effektiv zu nutzen, sie nicht zu verschwenden.
Und was haben Sie selbst als Klinikleiterin verändert?
Ich versuche, als Vorgesetzte Eltern konsequent mitzudenken. Und auch die Herausforderungen des weiblichen Körpers wie Menstruation oder Wechseljahre, und eine Kultur zu schaffen, in der wir einen starken Teamcharakter haben. Ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die während ihres Zyklus immer Migräne hat. Dann fällt sie einen Tag aus, aber dafür unterstützt sie das Team stärker an den anderen Tagen. Ich versuche eine überstundenfreie Klinik zu haben, das ist mir sehr wichtig. Natürlich fallen immer wieder mal Überstunden an, aber sie werden nicht erwartet und jede Überstunde muss mit mir oder mit der Oberärztin abgesprochen werden. Ärzte haben eine hohe Burnout-Rate und eine hohe Rate an Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit. Das liegt auch daran, dass man 24 Stunden am Tag für die Patienten da sein möchte, aber das kann man auf Dauer nicht aufrechterhalten.
Wie reagieren die männlichen Kollegen auf Sie?
Es gibt welche, die sich selbst einen Wandel wünschen und mir sagen: „Super! Mach das unbedingt weiter so!“ Dann gibt es welche, die darüber nachdenken, aber nichts sagen. Und dann gibt es diejenigen, die mich als existenzielle Bedrohung empfinden. Aber diese Männer müssen verstehen, dass wir Frauen schon immer existenziell bedroht sind. Wir sterben an der Medizin, weil sie nicht für uns gemacht ist. Und sie sollten verstehen, dass sie selbst nicht existenziell bedroht sind, nur weil die These im Raum steht, dass Frauen auch Menschen sind, die eine geschlechtergerechte Behandlung brauchen.
Rasseln Sie mit solchen Kollegen nicht aneinander?
Das passiert vor allem, wenn es um den § 218 geht. Da gibt es welche, die sagen: Ist doch super, wie es jetzt ist! oder die die aktuelle Rechtslage sogar noch verschärfen wollen. Da wird es schwierig in meinem Kopf, weil ich das als Eingriff in die Selbstbestimmung der Frau empfinde.
Sie kritisieren auch, dass bei der aktuellen Krankenhausreform das Thema Geburt praktisch keine Rolle spielt – obwohl so viele Geburtsstationen schließen. Was muss verbessert werden?
In der Kommission aus Expertinnen und Experten, die die Reform unterstützt hat, ist keine Hebamme oder Geburtshelferin dabei. Das empfinde ich als grundlegenden Fehler. Wir haben pro Jahr in Deutschland 690.000 Geburten, dazu kommen nochmal mehrere Hunderttausend Schwangere mit Fehlgeburten und 100.000 mit Schwangerschaftsabbrüchen plus die dazugehörigen männlichen Menschen. Das ergibt eine sehr hohe Zahl. Demgegenüber gibt es 200.000 Hirninfarkte, also eine Zehnerpotenz weniger. Der Hirninfarkt ist in der Reform ein zentrales Thema. Das passt nicht zusammen. Ja, wir brauchen eine Krankenhausreform, aber nicht auf Kosten von Schwangeren, die eine Versorgung benötigen.
Was müsste passieren, um die Schließung der Geburtsstationen zu stoppen?
So wie das System funktioniert, braucht man eine gewisse Anzahl an Geburten, damit sich das Schichtsystem aus Hebammen und Ärztinnen finanzieren kann. Daher ist es eine Frage, wieviel wir investieren wollen und welchen Wert wir dem Ereignis Geburt beimessen.
Müssten Geburten also besser bezahlt werden?
Ich finde schon. Man bekommt für eine ambulante Geburt rund 700 Euro, für eine stationäre Geburt 1.500 Euro und für einen Kaiserschnitt ungefähr 3.000 Euro. Das ist mit Blick darauf, wie lange Geburten oft dauern, unterfinanziert.

Was müsste noch geändert werden?
Es sollen ja große Gebärzentren eingerichtet werden. Da kann eine Frau mit einer problemlosen Schwangerschaft mit einer Hebamme ihr Kind bekommen. Wenn sie aber eine Risikoschwangerschaft hat, dann kann sie in diesen Zentren weitergeshiftet werden in einen Klinik-Kreißsaal oder in ein Perinatal-Zentrum. Das ist im Prinzip eine gute und interessante Idee. Nur sind diese Zentren nicht für alle Menschen zu erreichen. Und es wollen auch nicht alle diese großen Zentren. Deshalb könnten wir parallel auch eine starke ambulante Struktur schaffen, damit eine Familie nicht lange bis zum nächsten Kreißsaal reisen muss.
Ihre Mutter war Bauingenieurin und Kabarettistin, sie floh 1987 mit Ihnen aus der DDR nach Westdeutschland. Wie hat sie Sie geprägt?
Vor allem ist sie eine selbstbestimmte und arbeitende Mutter gewesen. Und sie war als Kabarettistin sehr politisiert und hat in der DDR unter dem System gelitten. Das hat mir vielleicht gezeigt, dass man Rahmenbedingungen ändern kann und dass Dinge nicht in Stein gemeißelt sind. Und dass es wichtig ist, Frauen im öffentlichen Leben und in der Gesellschaft zu halten. Viele Frauen ziehen sich ja ins Private zurück und sind dann eben liebende Partnerin und sorgende Mutter und engagieren sich nicht mehr in der Gesellschaft.
Im Gegensatz zu Ihnen …
Ich will die Dinge auch für meine Freundinnen und für meine Töchter verändern. Und ich denke mir: Ich habe halt die Energie, also mache ich das.
Das Interview führte Chantal Louis.
Weiterlesen
Mandy Mangler: "Das große Gynbuch" (Insel, 30 €). Lese-Termine: www.suhrkamp.de