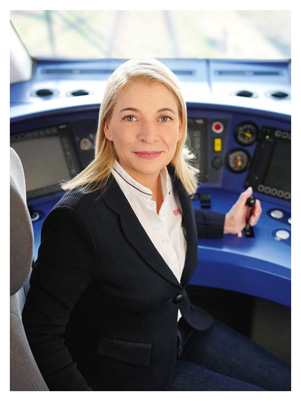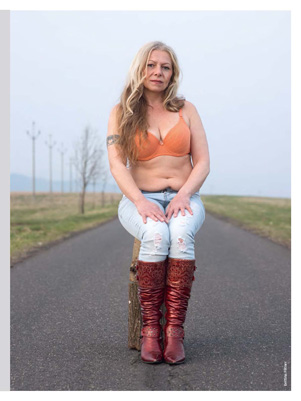Afghanin rettet als Mann ihr Leben
Nadia Ghulam, Sie haben in Afghanistan als Jugendliche und später als junge Frau in Männerkleidung über zehn Jahre unter Männern gelebt. Warum?
Nadia Ghulam: Seit meiner Geburt herrscht in meiner Heimat Afghanistan Krieg. Die Rakete schlug nachts in unserem Schlafraum ein. Meine Mutter rannte raus, um Hilfe zu holen. Ich wurde durch die Explosion schwer verletzt und erlitt starke Verbrennungen. Zum Glück fand meine Familie ein Krankenhaus, das mich aufnahm. Nach den ersten sechs Monaten im Koma verbrachte ich noch weitere anderthalb Jahre in stationärer Behandlung. Als ich zehn Jahre alt war, kamen die Taliban an die Macht. Sie untersagten den Frauen zu arbeiten, darum konnten auch die Krankenschwestern die Patienten in den Krankenhäusern nicht mehr versorgen. Ich war hilflos. Auch meine Familie konnte mich nicht mehr unterstützen: Mein Vater hatte nach dem Raketenangriff den Verstand verloren, mein Bruder und alle weiteren männlichen Familienmitglieder waren getötet worden. Nur meine beiden Schwestern und meine Mutter waren noch da. Es war zu der Zeit üblich, selbst ganz kleine Mädchen im Alter ab fünf Jahren mit älteren oder alten Männern zu verheiraten. Ich konnte aber nicht verheiratet werden, weil meine Brandwunden mich entstellt hatten. Somit war das Überleben unserer Familie nicht gesichert. Ich fasste also mit zehn Jahren den Entschluss, mich als Junge auszugeben, um arbeiten gehen zu können – dies alles in der Hoffnung und im Glauben, dass der Spuk mit den Taliban nur vorübergehend und schnell vorbei sein würde. Was nicht der Fall war. Ich lebte weiter als Junge, es gab kein Zurück mehr.
Was haben Sie in der Zeit gearbeitet?
Ich bin zuerst zu den Bauern aufs Feld gegangen, aber dort haben sie mich, weil ich ja noch Kind war, nur ausgelacht. Als ich anbot, zunächst ohne Lohn auf das Vieh aufzupassen, hat man es mir gestattet. Und ich bekam doch etwas Geld für meine Familie. Vier Jahre habe ich auf dem Feld gearbeitet. Danach arbeitete ich als Brunnenbauer und ab und zu als Koch bei den Taliban. Nachdem die vertrieben worden waren, gab es für mich Arbeit zuhauf. Ich arbeitete auf dem Bau. So konnte ich den Lebensunterhalt für meine Familie sichern und sogar noch etwas sparen, womit ich dann eine kleine Fahrradwerkstatt eröffnete.
Was waren für Sie die größten Schwierigkeiten als Frau in der Rolle eines Mannes?
Ich wuchs und wurde natürlich fraulicher. Nach einem Wachstumsschub mit 15 fragte mich der etwa gleichaltrige Sohn meines Arbeitgebers, warum ich mich denn so verändert hätte – da bekam ich Angst, dass herauskommt, dass ich ein Mädchen bin. Ich beobachtete das Verhalten der Jungen und versuchte, mich ebenso zu bewegen. Als ein vorbeigehender Mann die Jungen ansprach, warum sie mit mir nicht spielen, fasste ich Mut, dass ich doch wie ein Junge aussehe. Als der Mann mich nach meinem Namen fragte, war ich darauf nicht vorbereitet – unter Stottern nannte ich ihm dann den Vornamen meines Bruders, dessen Kleider ich ja auch trug: „Esmarai“. Zurück zu Hause bat ich meine Mutter, mich fortan nicht mehr Nadia, sondern Esmarai zu rufen.
Und wie haben Sie sich zu Hause in der Familie verhalten?
Auch als Junge. Selbst geschlafen habe ich in Jungenkleidung. Ich erinnere mich an eine Begebenheit so wie gestern: Eines frühen Morgens wurde ich durch lautes Rufen „Esmarai, Esmarai“ geweckt – es war meine Mutter. In Panik, weil ich dachte, die Taliban sind ins Haus gekommen, habe ich rasch meinen Turban aufgesetzt und bin zu ihr. Sie betete laut und nannte dabei immer wieder den Namen ihres mit 15 Jahren getöteten Sohnes Esmarai. Sie hatte meinen Namen geübt! Mittlerweile hat sie meinen eigentlichen Namen vergessen. Rufe ich sie heute aus Spanien zu Hause in Afghanistan an, so spricht sie mich stets an: „Wie geht es dir, mein Sohn Esmarai?“
Hatten Sie denn als Mädchen nicht auch den Drang, mit anderen Mädchen zu reden und mit ihnen zu spielen?
Doch. Ich habe mich ja oft sehr einsam gefühlt. Aber die Gelegenheiten gab es auch kaum – es war Krieg in Kabul, wir wurden hin- und hergetrieben, sehr viele Menschen waren vor Terror und Gewalt auf der Flucht. Wir wurden von Verwandten und Freunden getrennt und unser Stadtteil war sehr rasch menschenleer, außer uns gab es nur wilde Katzen und Hunde. Oft hatte ich Angst. Meine Mutter sagte dann immer: „Wenn du unterwegs bist, rede mit dir und stell dir vor, dass es hier auch andere Menschen gibt, die du nur nicht siehst. So wirst du deine Angst überwinden und du fühlst dich nicht alleine.“ Das hat mir geholfen.
Was wäre geschehen, wenn jemand von Ihrem Versteckspiel als Junge erfahren hätte?
Die Situation in Afghanistan ist bis heute besonders für Frauen nicht einfach. Eine Frau geht ohne ihren Mann nicht alleine aus dem Haus und gibt keinem anderen Mann die Hand – und ich bin alleine aus dem Haus gegangen, habe unter Männern gearbeitet und ihnen selbstverständlich auch die Hand gegeben. Und ich bin sogar Fahrrad gefahren. Wäre ich aufgeflogen, hätte man mich öffentlich gesteinigt. Frauen war und ist in großen Teilen auch heute noch vieles nicht erlaubt. Ich liebte Fahrradfahren – ich hatte eines, aber nur als Junge konnte, durfte und habe ich es gefahren. Ich liebte Kinofilme – als Frau und in der Talibanzeit war es generell für alle verboten, ins Kino zu gehen. Nur als Junge konnte ich in die versteckten, inoffiziellen Kellerkinos gehen. Stets hatte ich ein Messer bei mir, das ich bei Entlarvung gegen mich selbst gerichtet hätte. Ich hatte keine Angst vor dem Tod – viel mehr hatte ich Angst vor dem Verlust meiner Freiheit.
Wie haben Sie sich trotz allem Zugang zu Bildung verschafft?
Durch meine Existenz als Junge ergaben sich für mich etliche Möglichkeiten, mich zu bilden. Als Junge konnte, durfte ich ja in die Moscheen gehen. Dort fing ich an, lesen zu lernen, nach den Taliban-Regeln. Zu Hause sagte ich zu meiner Mutter: „Allah ist groß und barmherzig. Allah hilft uns, Allah hilft allen.“ Doch draußen galt etwas gänzlich anderes: Frauen dürfen bis heute nicht alleine das Haus verlassen, Mädchen und Frauen erhalten keine Bildung, Allah will nicht, dass Frauen arbeiten, dass man Musik hört oder Fernsehen sieht. Immer deutlicher wurde mir, dass die Lehre uns um Jahrhunderte zurückbringen wollte. Ganz früher gab es keine Flugzeuge, keine Autos, man reiste auf Pferden und Kamelen – sollen wir dies heute auch wieder tun? Und auch in vielen anderen Bereichen des Lebens sah ich genau die gleichen und für mich nicht aufzulösenden Unvereinbarkeiten. Dies war der Hauptgrund, dass ich unmittelbar nach dem Ende der Schreckensherrschaft der Taliban mit 16 Jahren die erste Möglichkeit nutzte, zur Schule zu gehen und endlich richtig Lesen und Schreiben zu lernen. Mir fiel das Lernen leicht und ich war begierig, so viel wie möglich zu lernen. So konnte ich in wenigen Jahren zwei Klassen überspringen und es letztendlich dann bis zur 12. Klasse schaffen. Aber als ich nach Europa kam, musste ich feststellen, dass mein Wissen trotz der Schulausbildung in Afghanistan hier das eines Analphabeten war. Erst hier in meiner neuen Heimat Spanien habe ich eine „richtige“ Schule mit breitem Bildungsangebot be- sucht, danach die Ausbildung im Bereich Informatik und Sozialintegration abgeschlossen und dann meinen Magister im Fach „Internationale Entwicklung“ gemacht.
Und wenn Sie auf Ihr Leben als Mann zurückblicken?
Weil ich mein halbes Leben als Mann unter Männern zugebracht habe, weiß ich, dass auch die Männer unter den Zwängen aus Tradition, Religion und Sitten sehr oft leiden. Viele haben sich unter Tränen beklagt, dass man ihnen den Willen der Familie aufzwang. So konnten und durften sie nicht entscheiden, welches Mädchen sie heiraten, oder dass sie sich von ihren Schwestern trennen mussten. Geht ein Mann gegen diese Mechanismen an, gilt er – besonders bei den weiblichen Familienangehörigen – als unmännlich und wird dafür scharf kritisiert. Auch die Männer leben also in einer Doppelmoral. Auch ich musste mich so verhalten, wie die Gesellschaft und die Tradition es von mir erwarteten. Sonst gehört man nicht mehr dazu und wird sanktioniert. So habe ich auch wie ein „echter“ Mann darauf bestanden, dass meine Mutter und Schwestern sich nur in der Burka außerhalb des Hauses bewegen und sie sich streng nach der Tradition verhalten.
Gerade in der letzten Zeit haben die Belästigungen der Frauen in Afghanistan und besonders in Kabul zugenommen. Hatten Sie auch an Belästigungen aktiv teilgenommen?
Ja, sehr oft sogar. Denn, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre mir vorgeworfen worden, kein echter Mann zu sein. Wenn man als Mann leben wollte, musste man seine Männlichkeit zeigen und mit den Wölfen heulen. Darunter habe ich sehr gelitten – aber, hätte ich es nicht gemacht, wäre ich aufgeflogen. Alleine kann man nichts bewegen – man wird bewegt. Ein Ende dieser unsinnigen und erniedrigenden Regeln kann nur durch das Aufstehen vieler Frauen in Gang gesetzt werden. Es muss doch möglich sein auszugehen und sich ohne Schleier normal in der Öffentlichkeit zu bewegen und auch mein geliebtes Fahrradfahren, ohne dass alles strafend aus den Fenstern schaut! Frauen und Männer müssen gemeinsam antreten, um eine wirkliche Veränderung in Afghanistan herbeizuführen.
Wie war das am Anfang, als Sie nach Spanien kamen?
Als ich hier ankam, litt ich unter so schweren psychischen Problemen, dass ich in psychiatrische Behandlung gebracht werden musste. Gleich zu Anfang der Behandlung habe ich zu dem Arzt gesagt, dass ich keine Frau sein wollte. Als er mich fragte, warum nicht, erwiderte ich ihm, dass ich doch alleine ausgehen möchte, ich will Freunde haben, ich möchte ein Fahrrad haben und ich möchte mit Mädchen und mit Jungs reden können. Er erwiderte, dass ich doch hier als Frau das alles problemlos machen kann. Doch als ich Afghanistan besuchte, bin ich noch einmal in die Männerrolle geschlüpft. Die Gegend der Wohnung meiner Mutter ist für Frauen mittlerweile sehr gefährlich geworden – um bei der Suche nach einer neuen Wohnung für meine Mutter Erfolg zu haben, war es erforderlich, dabei als Mann aufzutreten und zu handeln.
Sie haben in Ihrer Zeit in Spanien drei Bücher geschrieben …
… ganz zu Anfang freute ich mich, überhaupt studieren zu können. Vor lauter Freude bin ich am ersten Tag schon um sechs Uhr dorthin gegangen, obwohl es erst um acht Uhr losging. Ganz besonders war ich begeistert darüber, dass es für jeden Studenten einen Computer gab. Ich war regelrecht euphorisiert. Rasch kam ich auch mit meinen Kommilitonen in Kontakt. Ich musste aber immer wieder feststellen, dass mit dem Nennen meiner Herkunft Afghanistan ich als erstes von ihnen „Taliban“, „Osama bin Laden“, „Burka“, „Krieg“ usw. hören musste – das machte mich dann sehr traurig. Zumal auch die Medien ständig davon berichteten. Keiner hatte eine Vorstellung von den Hoffnungen, Sehnsüchten und Wünschen der Frauen und Mädchen in Afghanistan. Da ist in mir der Entschluss gereift, über diese hier so unbekannte Seite des Lebens dort in Afghanistan in meinem ersten Buch zu schreiben. Gibt es doch in meiner alten Heimat so unheimlich viele Menschen, die so sehr von Freiheit, Freizügigkeit und Bildung träumen.