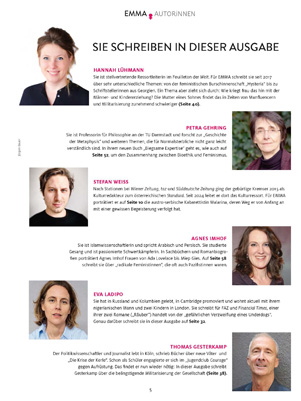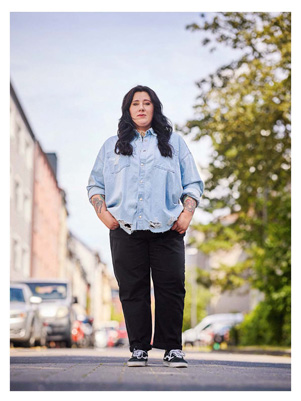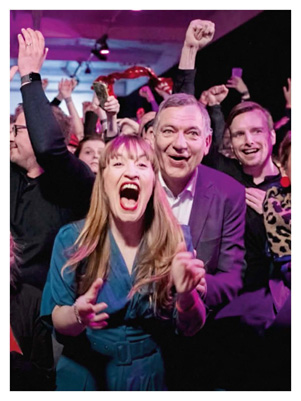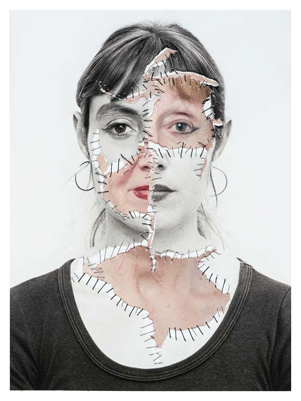Gender Gap: Frauen wählen anders...
28. September 2008. Bayern hat gewählt. Die CSU hat 17 Prozent verloren, die absolute Mehrheit ist perdu, die Kommentatoren sprechen von einem „Erdrutsch“. Dann folgt das übliche Ritual: die Wahlanalyse nach Wählergruppen. Die Grafiken, die Jörg Schönenborn gewohnt routiniert präsentiert, sind aufschlussreich. Wie haben Arbeiter im Unterschied zu Angestellten und Beamten gewählt? Sind Großstadtbewohner stärker zu den Freien Wählern abgewandert als Wähler in Gemeinden unter 5.000 Einwohnern? Sind die Christdemokraten auch bei ihrer Klientel über 60 Jahre in Ungnade gefallen?
Für die Parteien sind das hochinteressante Informationen, entnehmen sie ihnen doch, wie zufrieden oder unzufrieden einzelne Bevölkerungsgruppen mit dieser oder jener Partei sind. Und tunlichst werden sie von nun an die sich vernachlässigt fühlenden Gruppen stärker beachten. Und auch die vernachlässigten Gruppen sind zufrieden: Die da oben haben verstanden. Umso erstaunlicher, dass die Kluft im Wählerverhalten zwischen der am stärksten auseinanderdriftenden Gruppen mit regelmäßiger Gewissheit kein Thema ist: die zwischen Frauen und Männern.
Die Kategorie „Geschlecht“ taucht in keinem dieser Säulen-, Torten- oder Kurvendiagramme auf, die an Wahlabenden so zahlreich präsentiert werden. Was mitnichten daran liegt, dass Männer und Frauen ohnehin mehr oder weniger das gleiche wählen. Im Gegenteil: In kaum einer Bevölkerungsgruppe sind die Unterschiede im Wahlverhalten so groß wie zwischen den Geschlechtern. So haben zum Beispiel in Bayern 45 Prozent der männlichen Wähler bei der CSU ihr Kreuz gemacht, aber nur 42 Prozent der weiblichen Wähler. 15 Prozent der Bayern haben sich von Huber, Beckstein & Co. abgewandt - aber 19 Prozent der Bayerinnen. Dramatisch wird der sogenannte Gender Gap, die Geschlechterkluft, wenn man die Kategorie „Alter“ hinzuzieht: So hätte die CSU bei Männern über 60 mit 55 Prozent immer noch die absolute Mehrheit. Bei Frauen zwischen 33 und 44 Jahren jedoch würde ihr selbst eine Koalition mit der FDP nicht weiterhelfen, denn hier kommt sie gerade noch auf ein Drittel der Stimmen, nämlich 33 Prozent. Eine stolze Differenz von 22 Prozent!
Eigentlich eine Sensation. Erstaunlich, dass trotzdem niemand darüber spricht. Oder hat das Gründe? Stellen wir uns vor, Jörg Schönenborn und seine Kollegen hätten auch zum unterschiedlichen Wahlverhalten der Geschlechter ein oder gar mehrere aufschlussreiche Säulendiagramme parat. Was dann? Ja, dann könnten Frauen durchaus auf die Idee kommen, dass ihr Kreuzchen in der Wahlkabine nicht nur ihre ganz persönliche Entscheidung war, sondern womöglich Ausdruck gemeinsamer Interessen oder Hoffnungen (auf mehr Kinderbetreuungsplätze, weniger alte Herren im Kabinett oder was auch immer). Sie könnten anfangen, sich als Interessengruppe zu begreifen, Lobbys bilden, Druck machen auf die Parteien, damit die ihre Anliegen berücksichtigen – ja, dies sogar zum wahlentscheidenden Faktor machen.
Zwar wählen Frauen seit Einführung des Frauenwahlrechts anders als Männer – seit Anfang der 70er zum Beispiel eher links und eklatant weniger rechtsaußen – aber sie wissen es nicht. Und so ist es kein Wunder, dass sie – anders als zum Beispiel in den USA, wo der Gender Gap spätestens seit der Reagan-Wahl 1980 auch medial eine große Rolle spielt – sich eben nicht als Interessengruppe formieren und bei den Parteien zu Wort melden. Und das, obwohl sie die Mehrheit der WählerInnen stellen.
Das war einmal anders. Bei der ersten Wahl, bei der Frauen mitwählen durften, war der Gender Gap noch Thema. Vor allem die Sozialdemokraten sprachen davon, besser gesagt: sie fluchten darüber. Denn es hieß, dass die Frauen, die an diesem 19. Januar 1919 zum ersten Mal den Gang zur Urne antraten, die SPD die absolute Mehrheit gekostet hätten. Mag sein. Später, ab 1972, war es jedenfalls genau umgekehrt: Es waren die Frauen, die der SPD zur Macht verhielfen.
Damals war der Erste Weltkrieg gerade zu Ende gegangen, Kaiser Wilhelm hatte abgedankt und das Land verlassen, und Reichskanzler Max von Baden hatte die Regierung an den Sozialdemokraten Friedrich Ebert übergeben. Einen Tag nach Kriegsende riefen Ebert und sein „Rat der Volksbeauftragten“ die Wahlen zur ersten deutschen Nationalversammlung aus. Und, sie erklärten die Frauen, die bis zum Schluss mit vereinten Kräften für ihr Stimmrecht gekämpft hatten, für wahlberechtigt. Die nutzten ihr neues Recht massenhaft: Die Wahlbeteiligung lag mit über 82 Prozent praktisch genauso hoch wie die der Männer. Die jungen Frauen treibt es sogar stärker an die Urnen als ihre Altersgenossen: Gut 80 Prozent der Erstwählerinnen werfen ihren Stimmzettel ein – aber nur 60 Prozent der Erstwähler (und Kriegsheimkehrer). Unter den WählerInnen zwischen 20 und 25 Jahren liegt die Differenz bei der Wahlbeteiligung immer noch bei stolzen zehn Prozent.
Bei den ersten Wahlen zur Nationalversammlung werden die Sozialdemokraten mit knapp 38 Prozent stärkste Partei. Zählt man die gut sieben Prozent ihres radikaleren Ablegers, der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD) dazu, erreichen die linken Parteien im Reichstag 45 Prozent. Wie die Frauen tatsächlich gewählt haben, darüber gibt es nur eine schmale Datenbasis, nämlich die Auszählung von drei Stimmbezirken getrennt nach Geschlecht. In diesen drei Bezirken – Köln, Neustadt und Bruchsal – klafft jedoch in der Tat eine gewaltige Geschlechterlücke: Nur 32 Prozent der Kölnerinnen stimmten für SPD/USPD (Männer: 46 Prozent), in Neustadt 35 Prozent (Männer: 44 Prozent) und in Bruchsal sogar nur 21 Prozent (Männer: 39 Prozent).
Zwischen 1914 und 1918 verlor die SPD auch über die Hälfte ihrer weiblichen Mitglieder. Der Krieg wird letztendlich für die – zunächst ebenfalls nationalistische und kriegseuphorische – Mehrheit der Sozialdemokratinnen eine Rolle dabei gespielt haben. Denn auch ihre Partei hatte alle Kriegskredite durchgewinkt.
Ein zweiter Grund für den Gender Gap in Sachen Sozialdemokratie liegt zweifellos darin, dass sich die unterschiedlichen Lebenswelten von Frauen und Männern auch auf ihre Parteipräferenzen auswirkten: Die berufstätigen Männer bewegten sich stärker im Dunstkreis von Gewerkschaften und Arbeitervereinen, die Hausfrauen waren stärker konfessionell verwurzelt und engagieren sich in Gemeinden und kirchlichen Verbänden. Die „klerikale Gefahr“ hatten Sozialdemokraten das genannt. Und so überrascht es nicht, dass sich bereits bei dieser ersten Reichstagswahl ein Wahlverhalten der Geschlechter zeigt, das als „Weimarer Muster“ bezeichnet wird, sich de facto aber Ende der 60er Jahre bis in die Bundesrepublik fortsetzt: Frauen wählen weniger links und dafür mehr kirchlich-konservativ. Die Zentrumspartei, Vorläuferin der CDU, bekommt 1919 von weiblichen Wählern 15 bis 20 Prozent mehr Stimmen als von männlichen. Dieser Vorsprung wird sich in den folgenden Jahren auf runde fünf Prozent verringern, aber er bleibt konstant.
Was sich ebenfalls drastisch verringert, ist die Wahlbeteiligung der Frauen. Schon ein Jahr nach dem Paukenschlag am historischen ersten Wahltag gehen statt 84 nur noch 63 Prozent der Frauen zur Wahl. Zwar sind auch die Männer wahlmüder geworden, aber von ihnen geben immerhin 72 Prozent ihre Stimme ab. Es liegt nahe, dass die Frauen desillusioniert sind: Der Aufbruch, den der 19. Januar 1919 symbolisierte, wurde schon bald hart gebremst. Der Anteil der weiblichen Abgeordneten im ersten demokratischen gewählten Parlament beträgt knapp 9 Prozent (ein Anteil, der erst 1983 überschritten werden sollte). Und die neue Regierung aus SPD, Zentrum und der liberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP) hatte rasch zwei äußerst frauenfeindliche Gesetze verabschiedet.
In der „Verordnung über die Freimachung von Arbeitsstellen während der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung“ beschließt die „Weimarer Koalition“ im März 1919, dass Frauen, die während des Krieges die Jobs von Männern übernommen hatten, diese wieder räumen müssen: „In erster Linie muss Frauenarbeit möglichst beseitigt werden.“ Dem Heim-an-den-Herd-Gesetz folgte im Juli die Verabschiedung der Weimarer Verfassung. „Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten“, heißt es da in Artikel 109. Das Wörtchen „grundsätzlich“ aber bedeutet: Es gibt Ausnahmen.
Im Familienrecht beispielsweise herrscht die gleiche Entmündigung, gegen die die Frauen schon seit Jahrzehnten heftig gekämpft hatten: Eine Frau gibt mit ihrer Eheschließung ihre Bürgerrechte weitgehend ab. Der Ehemann hat als Familienoberhaupt das Recht auf ihr Geld und die Kinder, er darf ihr Berufstätigkeit verbieten und ihre Kaufverträge kündigen.
Elisabeth Selbert, Sozialdemokratin und Mitglied der verfassungsgebenden Versammlung von 1949, weiß, warum sie und die anderen drei „Mütter des Grundgesetzes“ so heftig – und erfolgreich – dafür streiten, dass das Wort „grundsätzlich“ aus dem Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 gestrichen wird. Die fraglichen Gesetze werden dennoch erst 1958 aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch entfernt.
Anfang der 1920er Jahre jedenfalls ziehen sich die weiblichen Wähler, die zunächst so optimistisch an die Urnen getreten sind, wieder zurück. Erst in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts wird sich der Gender Gap, der 1924 bei zwölf Prozent liegt, langsam wieder verringern. 1930 liegt er bei sechs Prozent. Jetzt, in Zeiten von Weltwirtschafskrise und Rekordarbeitslosigkeit, wollen wieder knapp 80 Prozent der Wählerinnen mitbestimmen über das Schicksal ihres Landes.
Angeblich taten sie das auf unglückliche Art und Weise. „Die Frauen haben Hitler an die Macht gewählt.“ So lautet der wohl bekannteste Satz über den Gender Gap. Er stimmt nur so nicht. Während der gesamten Zwanziger Jahre waren die weiblichen Wähler der NSDAP gegenüber sogar zurückhaltender als die männlichen. Auch bei der Wahl des Reichspräsidenten 1932 stimmten 36 Prozent der Männer für den künftigen Diktator und 33 Prozent der Frauen. Bei den Reichstagswahlen ab 1932 ist ein Blick auf die regionalen Unterschiede zwingend, denn der zeigt einen enormen Unterschied im Wahlverhalten: Während unter den weiblichen Wählern in protestantischen Gebieten wie Bremen oder Magdeburg tatsächlich durchschnittlich zwei Prozent mehr für die NSDAP stimmten, sieht es in katholischen Regionen genau umgekehrt aus. So stimmten zum Beispiel in Köln oder Regensburg mehr Männer für die Nazis, bis zu sechs Prozent. Hier macht sich die kirchliche Bindung der Frauen bemerkbar, die für so manche zu einem Votum gegen Hitler führt.
Eine der ersten Amtshandlungen der Nationalsozialisten besteht darin, den Frauen das passive Wahlrecht zu entziehen. Frauen dürfen im Dritten Reich also kein politisches Mandat mehr ausüben. Das aktive Wahlrecht wird in den nächsten zwölf Jahren ohnehin für beide Geschlechter Makulatur sein.
Ausgerechnet bei den ersten Bundestagswahlen nach Kriegsende 14. August 1949 - jenem Jahr, in dem die westdeutschen Frauen durch Massenproteste in der Verfassung den Artikel „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ durchgesetzt und sich als ernstzunehmender politischer Faktor in die Bundesrepublik eingebracht hatten – hielt es niemand für nötig zu erheben, wie die weibliche Bevölkerung gewählt hatte. Die Repräsentative Wahlstatistik wird erst 1953 eingeführt, und sie zeigt: In den folgenden 20 Jahren setzen Frauen das „Weimarer Muster“ fort. Als die CDU/CSU unter Konrad Adenauer bei den zweiten Bundestagswahlen mit 43 Prozent wieder stärkste Partei wird, hat sie das vor allem den Frauen zu verdanken, die fast zur Hälfte, nämlich mit 47 Prozent für die Konservativen stimmen (Männer: 39 Prozent).
Und in der Deutschen Demokratischen Republik? Aus der DDR sind keine geschlechtsspezifischen Analysen bekannt. Allerdings erklärt man sich das unerwartet schlecht Abschneiden der Kommunisten bei den Gemeindewahlen 1946 in der Sowjetischen besetzten Zone bei den Wählerinnen mit ihrer Reserviertheit den propagierten russischen Freunden gegenüber. Denn die Frauen hatten in der SBZ massenhaft die schmerzliche Erfahrung der Vergewaltigung durch russische Soldaten im und nach dem Krieg gemacht.
In der Bundesrepublik stehen, ganz wie nach Ende des Ersten Weltkriegs, die Zeichen wieder auf Hausfrauisierung. Die Trümmerfrauen sind zurück an den Herd gepfiffen worden und haben die Kittelschürze umgebunden. Familienminister Franz-Josef Wuermeling verkündet die staatliche Pflicht, „der Frau und Mutter den Verzicht auf familienfremde Tätigkeit so weit wie möglich zu erleichtern, weil das Wirken der Hausfrau und Mutter in der Familie für das Gemeinwohl von ungleich höherem Wert ist als der wirtschaftliche Nutzen aus Fabrik- und Büroarbeit.“
Ein Teil der Frauen, der noch tief geprägt ist von der nationalsozialistischen Mutterkreuz-Propaganda und verunsichert von der Reaktion der Kriegsheimkehrer auf den kriegsbedingten Rollenwechsel, hört solche Worte gern. Der andere, der frustriert ist vom „Zurück auf Los“ in Sachen Geschlechterrollen, hat von den linken Genossen keine Unterstützung zu erwarten. Die Arbeiter und Gewerkschafter sind klassische Männerbünde, in denen Frauen nur eine marginale Rolle spielen. Die Konservativen verstehen sich immerhin prächtig auf das „Lob der Hausfrau“. Das trägt ihnen, vor allem bei den älteren Frauen, ein Plus von rund acht Prozent ein.
Der Linksruck der Frauen kommt im Westen mit dem Aufbruch der Studenten- und Frauenbewegung. Bereits 1969, als Willi Brandt nach der Großen Koalition erstmals Bundeskanzler wird, ist das Frauendefizit der SPD erheblich abgeschmolzen. 1972 dann wird die SPD mit fast 46 Prozent der Stimmen zum ersten Mal stärkste Partei im Bundestag. Der sozialdemokratische Gender Gap ist nun mit 1,2 Prozent auf Tiefstand. Gleichzeitig ist die Wahlbeteiligung der Frauen, die stets etwa drei Prozent unter der der Männer gelegen hatte, bei diesen Wahlen sprunghaft angestiegen: Über 90 Prozent der Wählerinnen geht diesmal zur Urne (Männer: 91), die höchste Zahl in der Geschichte des Frauenwahlrechts. Die Konservativen hingegen verbuchen Gewinne bei den Männern. Das Statistische Bundesamt verkündet: „Die Frauen verhalfen der SPD in den Sattel“.
Ein Zufall ist das nicht. Ein Jahr zuvor ist auch in Deutschland die Frauenbewegung gestartet. Der § 218 wird zur zentralen Frage, an der sich der Protest der Frauen entzündet – und die SPD scheint die Partei, mit der die Fristenlösung durchgesetzt werden könnte. Die CDU/CSU ist strikt und unverrückbar gegen die Reform, wirklich auf die Fahnen geschrieben hat sie sich nur die FDP (die allerdings bis heute leicht von Männern bevorzugt wird). 1975 wird die sozial-liberale Koalition den straffreien Schwangerschaftsabbruch in den ersten drei Monaten beschließen (ohne Kanzler Brandt, der bei der Abstimmung den Saal verlässt) – ein Jahr später wird das Gesetz aufgrund einer Verfassungsklage der Union vom Verfassungsgericht kassiert. 1980 werden die Sozialdemokraten zum ersten Mal in der Geschichte ihrer Existenz von mehr Frauen als Männern gewählt. Das wird von nun an so bleiben.
Einen konstanten Frauenbonus kann noch eine weitere Partei für sich verbuchen, die nun neu auf die politische Bühne tritt: die Grünen. Zwar sind die weiblichen Wähler zunächst skeptisch gegenüber dieser neuen Truppe aus Turnschuhträgern und Studentenrevoluzzern – wie Frauen generell erheblich zurückhaltender bei Parteien an den linken und rechten Rändern sind. So ist zum Beispiel die KPD in Weimarer Republik und Nachkriegszeit stets eine klare Männerpartei gewesen und wird heute auch Die Linke deutlich von Männern bevorzugt.
Aber in den 80er Jahren sorgen schon bald Frauenquote sowie Umweltschutz und deklarierter Pazifismus für einen klaren Frauenüberschuss bei den Grünen.
Die rechtsaußen Parteien hingegen, die nun immer massiver auf der Bildfläche erscheinen und immer stärkere Wahlerfolge verbuchen können, würden ohne ihre männlichen Wähler in der Versenkung verschwinden. DVU oder Republikaner werden zu zwei Dritteln von Männern gewählt. Dürften nur Frauen an die Urnen, würden alle rechtsradikalen Parteien in Deutschland an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Auch das sagt niemand.
Als Helmut Kohl 1982 die rotgelbe Koalition ablöst, zunächst via Misstrauensvotum und 1983 via Wahl, da ist der traditionelle Wählerinnenüberschuss der CDU, der 1969 noch knapp zehn Prozent betragen hatte, auf 1,5 Prozent zusammengeschrumpft. Und dieses Plus geht ausschließlich auf das Konto der älteren Wählerinnen. Bei den Frauen unter 35 sind die Konservativen satt im Minus und die Sozialdemokraten im Plus.
Der Regierungswechsel 1998 von Kohl zu Schröder war entscheidend der Tatsache zuzuschreiben, dass rund fünf Prozent der Frauen von der CDU zur SPD abgewandert sind, während die Männer in ihrer Wahlentscheidung konstant blieben. Ebenso so eindeutig hat das Herrenduo Schröder/Fischer seine Wiederwahl dem Gender Gap zu verdanken. 2002 wandern fünf Prozent der SPD-Wähler zur CDU ab, während die Mehrheit der Frauen ihr Kreuz erneut bei Rotgrün machten. Was vermutlich mit der demonstrativen Ablehnung des Irakkriegs durch den Kanzler zu tun haben dürfte, der ansonsten nicht durch seine besondere Affinität zu Frauenfragen auffällt, Stichwort: Gedöns.
Doch kommen wir zur Gretchenfrage: Wählen Frauen Frauen? Manchmal schon. Die weiblichen Wähler, so triumphierte die SPD nach dem knappen Sieg der ersten deutschen Kanzlerin, hätten Merkel zu drei Prozent weniger gewählt als Stoiber 2002. Hier lohnt sich allerdings ein zweiter Blick. Der ergibt erstens: Mehr Frauen als Männer haben 2002 die CDU, sprich Angela Merkel, gewählt. Zweitens: Fast fünf Prozent der SPD-Wählerinnen sind 2005 Schröders SPD von der Fahne gegangen, aber nur ein Prozent Merkels CDU. Drittens: Dafür haben sich diesmal mehr Männer gegen die CDU entschieden, nämlich knapp drei Prozent. Die Frage könnte also auch lauten: Wählen Männer Frauen? Die Antwort: Offenbar ungern.
Zumindest in den USA ist die Antwort auf die Frage, ob Frauen einen weiblichen Kandidaten bevorzugen, klar und deutlich beantwortet: Dass Hillary Clinton vor allem bei den Wählerinnen punktete, und zwar vor allem bei solchen ihrer eigenen Altergruppe, und dass sie einigen Bundesstaaten ein Plus von zwölf Prozent gegenüber Barack Obama holte, das war in den Vereinigten Staaten Dauerthema in den Medien; ebenso wie die Tatsache, dass der Feldzug gegen die potenzielle Präsidentin mit harten sexistischen Bandagen geführt worden war.
Schon als 1980 Ronald Reagan ins Weiße Haus einzog, hatte die Tatsache, dass der Leinwand-Cowboy a.D. von acht Prozent mehr Männern als Frauen gewählt worden war, zum ersten Mal das unterschiedliche Wahlverhalten der Geschlechter zum Thema gemacht. Bill Clinton wird später ein Frauenplus von elf Prozent verzeichnen, und spätestens jetzt macht ein geflügeltes Wahl-Wort die Runde: „It’s the women, stupid!“ – Auf die Frauen kommt es an, du Blödmann. (Diese Abwandlung des ursprünglichen Spruches „It’s the economy, stupid!“ der auf die wirtschaftlichen Erfolge eines Präsidenten abhob, zeigt, wie ernst der Gender Gap andernorts genommen wird.)
Auch mindestens eine deutsche Politikerin weiß sicher, dass die weibliche Wählerschaft zu erdrutschartigen Siegen verhelfen kann: Andrea Ypsilanti. Dass Roland Koch bei den Hessen-Wahlen am 27.Januar 2008 rot sah, hat sie vor allem den Frauen, insbesondere den jungen Frauen zu verdanken. 38 Prozent der Hessinnen wählten die Kandidatin, die nicht nur in den frauenaffinen Bereichen Bildungs- und Umweltpolitik Innovation versprach, sondern auch mit ihrer Patchworkfamilien-WG die Abkehr vom Hausfrauenmodell vorlebt. Hätten die Frauen unter 30 allein wählen dürfen, hätte Ypsilanti fast allein regieren können: In dieser Alters- und Geschlechtsgruppe bekam sie 48 Prozent der Stimmen. Zusammen mit den Grünen, für die noch einmal zwölf Prozent der Jungwählerinnen votierten, wäre Rotgrün der Zweidrittel-Mehrheit nahe gewesen.
Nun steht uns also das Wahljahr 2009 bevor. Die CDU/CSU-Frauen mahnen innerhalb ihrer Parteien schon seit Jahren ein stärkeres Engagement für Frauen an. Und in der Tat ist mit von der Leyen & Co. ja auch so einiges in Gang gekommen. Vor allem aber haben die Konservativen, ob sie wollen oder nicht, einen Trumpf in der Hand: die Kanzlerin.
Wir dürfen gespannt sein, ob die Parteien wenigstens heimlich ihre Wahlanalysen studieren – und ob sie den Frauen diesmal etwas zu bieten haben im Wahlkampf. Ebenso stellt sich die dringliche Frage, ob die KollegInnen in den TV-Wahlstudios endlich die Objektivität haben werden, auch das Wahlverhalten der Geschlechter zum Thema zu machen. Denn eine Realität ist der Gender Gap ja schon lange. It’s the women, stupid.