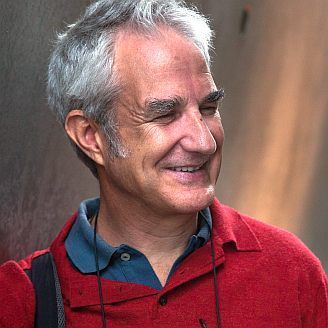Israel: Mütter gegen Gewalt
Israel brennt, und das nun schon seit über einem halben Jahr. Woche für Woche gehen Hunderttausende auf die Straße, darunter Frauengruppen wie „Women Wage Peace“ und „Mütter gegen Gewalt“, um gegen die antidemokratischen Gesetzgebungen der rechtsextremen Netanjahu-Regierung zu protestieren.
Das erste Gesetz der sogenannten Justizreform, die für die Protestbewegung ein „Staatsstreich auf dem Weg in die Diktatur“ ist, ist bereits verabschiedet. Es hebelt die Macht des Obersten Gerichtshofs aus, Gesetzgebungen der Regierung wegen mangelnder „Angemessenheit“ rückgängig zu machen. So können unter anderem ab sofort auch korrupte und vorbestrafte Politiker wie Arie Deri, der Vorsitzende der ultraorthodoxen Shas Partei, als Minister ernannt werden.
Über 200 weitere Gesetze könnten nach der Sommerpause folgen. Viele nehmen massiv die Frauenrechte unter Beschuss. Ein Beispiel von vielen: Die rabbinischen Gerichte, die ausschließlich von Männern besetzt sind und schon jetzt ein Monopol auf Eheschließungen und Scheidungen haben, sollen zukünftig auch über Alimente und anderes bestimmen können.
Empört demonstrieren Frauenrechtlerinnen nicht nur vor rabbinischen Gerichten. Auch gegenüber von einer fundamentalistischen Talmudschule, in der in der Regierung einflussreiche Rabbiner eine Konferenz abhielten, demonstrierten Ende Juli hunderte Frauen. Jüdisch-ultraorthodoxen Männern ist es aus „Keuschheitsgründen“ verboten, den Gesang von Frauen zu hören. Auf der Straße stimmen die Demonstrantinnen lauthals die inoffizielle Hymne der Protestbewegung an: „Ich habe kein anderes Land.“
In der Regierung geben neben Ultraorthodoxen vor allem Siedler aus den besetzten Palästinensergebieten den Ton an. Ginge es nach ihnen, würde Israel die Gebiete annektieren und zum Teil eines „Groß-Israels“ machen. Auch dagegen wehren sich immer mehr Frauen. Allen voran: eine Gruppe von Soldatenmüttern, deren Söhne in den besetzten Gebieten ihr Leben aufs Spiel setzen müssen.
Einmal die Woche machen sich die Friedensaktivistinnen von Tel Aviv aus auf den Weg in die Palästinensergebiete. Schon um 6 Uhr morgens ist es glühend heiß. In den Beduinendörfern in der Wüste, in die sie heute fahren, kann es 40 Grad im Schatten werden. Doch das schreckt die Frauen der Organisation „Mütter gegen Gewalt“ nicht ab.
Ihr Ziel heute: Al-Tuwani, ein abgelegenes Dorf zwischen den Hügeln Hebrons und dem Toten Meer. Immer wieder wird Al-Tuwani von bewaffneten jüdischen Siedlern terrorisiert. Erst am Tag zuvor ist eine Gruppe in die Olivenhaine des Palästinenserdorfs eingedrungen und setzte Jahrhunderte alte Bäume in Brand.
Die Fahrt nach Al-Tuwani geht vorbei an der Trennmauer, die Israel vor gut 20 Jahren an der Grenze zu den Palästinensergebieten hochgezogen hat. Nach Zusammenbruch des Friedensprozesses erschütterte damals eine Welle von palästinensischen Selbstmordanschlägen Israels Städte. Die Betonmauer hielt sie ab. Heute ist sie Symbol der schon 56 Jahre alten israelischen Militärbesatzung der Palästinenser.
„Wir leisten das Minimum an humanitärer Hilfestellung, die diese Menschen brauchen“, sagt Ketty Bar, die charismatische Gründerin der „Mütter gegen Gewalt“, während der Fahrt entlang der Mauer. „Auf der einen Seite rufen wir den Staat auf, unsere Söhne, die Soldaten aus den besetzten Gebieten abzuziehen. Auf der anderen Seite gehen wir in diese Dörfer, für die unsere Söhne die größten Feinde sind.“
Ein nur schwer auszuhaltender scheinbarer Widerspruch. Die Frauen bringen Medikamente, Kleidung, Lebensmittel, und vor allem: die Bitte um Verständnis. Es gäbe auch ein anderes Israel als das der Siedler und Besatzer.
Im Dorf werden sie von Nasser Suleiman alAdra empfangen. Wie viele Palästinenser spricht er fließend Hebräisch. Vor der 2. Intifada arbeiteten zehntausende Palästinenser in Israel auf Baustellen und in der Landwirtschaft. Heute ist Nasser einer der führenden Menschenrechtsaktivisten in den Hügeln von Hebron.
„Wir sind entschieden gegen diese Politik der Besatzung, der Unterdrückung und der Vertreibung“, beteuert Ketty, während Nassers Frau Kefah den traditionellen süßen Minztee serviert. „Unser Staat braucht eine Armee wie jeder andere Staat auch, aber so kann es nicht weitergehen. Und glaubt mir: Auch für die Soldaten, diese 18-jährigen Kinder, bringt der Dienst in den besetzten Gebieten schwere seelische Schäden mit sich.“
In Tel Aviv wissen das auch klinische Psychologen wie David Senesh. Er erforscht seit Jahren Posttraumata junger Soldaten, auch unter dem Aspekt der noch jungen Forschung moralischer Posttraumata. Das sind belastende Verletzungen, die aus Verhaltensweisen wie z. B. von Soldaten in Kriegsgebieten entstehen. Handlungen, die ihren eigenen Werten und moralischen Überzeugungen zuwiderlaufen.
Zwar hat die Armee selbst einen psychologischen Betreuungsdienst. Doch viele Soldaten der Kampfeinheiten ringen erst viel später mit den posttraumatischen Folgen ihrer Einsätze. „Manche dieser Posttraumata“, berichtet David Senesh, „sehen wir erst Jahre danach, wenn sie sich auf die nächste Generation auswirken. So gibt es manchmal Kinderpsychologen, die in der Arbeit plötzlich auf Spuren von traumatischen Erlebnissen stoßen, die der Vater des Kindes im Armeedienst erlebte.“
Anfang Juli drang die israelische Armee in das Flüchtlingslager der Stadt Dschenin ein, ein Brennpunkt von Widerstandskämpfern gegen die Besatzung. Drei Tage lang nahmen Soldaten teils Stellungen in bewohnten Häusern. 1.000 Bewohner des Lagers flohen vor den Gefechten. Nach palästinensischen Angaben verweigerte die Armee Krankenwagen oft den Zugang zu den Verletzten.
Doch viele der an solchen Einsätzen beteiligten Soldaten, so David Senesh, suchen nie Hilfe. „Oft wagen sie sich später nicht einmal an Ereignisse zu erinnern, in denen sie eigentlich hätten einschreiten oder die sie hätten verhindern sollen. Ein dunkles Kapitel, von dem weder Politiker und oft nicht einmal Psychologen wissen wollen.“
In Al-Tuwani frage ich Kefah al-Adra, wie sie den Besuch der israelischen Frauen empfindet, die einerseits Solidarität zeigen und Hilfe bringen, andererseits selbst die Mütter der Soldaten sind, die aktiven Wehrdienst in den besetzten Gebieten leisten. Die Palästinenserin weicht aus. In ihrem Dorf, sagt sie, sei jeder willkommen.
Die „Mütter gegen Gewalt“ stehen in einer langen Tradition israelischer Friedensaktivistinnen. Die Gruppe „Women in Black“ begann in Israel im Januar 1988, einige Monate nach Beginn der ersten palästinensischen Intifada, als israelisch-jüdische Frauen begannen, in Jerusalem gegen die Besatzung zu protestieren. Zehn Jahre später gründeten Soldatenmütter die Gruppe „Four Mothers“. Alle waren Mütter von Kämpfern im damals besetzten Südlibanon. Ihre Protestbewegung trug entschieden dazu bei, dass sich Israel drei Jahre später aus dem Libanon zurückzog.
Ketty Bar hat sich während den ersten großen Anti-Netanjahu Demonstrationen vor vier Jahren politisiert. Sie und ihre Mitstreiterinnen mussten mitansehen, wie die Polizei damals gegen Demonstranten vorging – mit einer Gewalt, die jede bisherige rote Linie überschritt. „Plötzlich sahen wir, wie das Verhalten dieser jungen Männer, die in den besetzten Gebieten Armeedienst geleistet haben, allmählich in unsere demokratische Gesellschaft sickert. Da verstanden wir: Wir müssen handeln.“
Eine Woche nach dem Besuch in Al-Tuwani sind die israelischen Mütter wieder im Westjordanland. Auf dem Weg zu einer Großdemonstration verschiedener Friedensorganisationen, die gegen den Bau einer neuen illegalen jüdischen Siedlung protestieren, machen sie Halt an den Militärcheckpoints. Auf ihren gelben, fluoreszierenden Westen steht „Mutter“, in Hebräisch, Englisch und Arabisch.
Ketty Bar sucht den Dialog mit einem jungen Rekruten, der an der Zufahrtsstraße zu einer jüdischen Siedlung Wache schiebt. Verunsichert ruft der Soldat per Funk seinen vorgesetzten Offizier. Minuten später kommt dieser in einem Jeep vorgefahren. Die Frauen, sagt er, befänden sich in einem militärischen Sperrgebiet. Wegen der angekündigten Demonstration dürften sie sich nicht dort aufhalten.
Ketty lässt sich nicht abbringen. „Uns ist es total wichtig, diese Message rüberzubringen“, sagt sie zu dem Offizier. „Deswegen sind wir hier. Uns geht es um die Sicherheit und um das Leben unserer Kinder. Wir müssen uns um euch sorgen, weil man euer Leben aufs Spiel setzt, nur um die Sicherheitsinteressen der Siedler umzusetzen.“
Geduldig lässt der Offizier sie ausreden. „Okay, Ketty. Wir haben gehört, was ihr zu sagen habt. Wirklich schöne Worte, aber jetzt müsst ihr von hier abhauen.“
Die Soldaten ziehen zu ihrem nächsten Einsatz, die Mütter in Richtung der verbotenen Großdemonstration. Die Armee wird Tränengas auf die Demonstranten schießen. Es wird Verletzte geben. Wenige Tage darauf sind die Soldatenmütter auf der allwöchentlichen Samstagsdemonstration in Tel Aviv. Doch selbst wenn Netanjahus Polizei- und Finanzminister aus der radikalen Siedlerbewegung stammen: die Besatzung ist kein Thema auf den Kundgebungen. Die Protestbewegung befürchtet, sonst den allgemeinen Konsens, die Unterstützung der breiten Gesellschaft zu verlieren.
Ketty Bar schwimmt gegen den Strom. „Wir sagen den Leuten hier: Ihr redet von Demokratie und schickt eure Kinder in eine Armee, die von diesen radikalen Ministern mitgesteuert wird? Das macht doch keinen Sinn!“
Das will in Israel heute kaum jemand hören. Die breite Masse ist nicht bereit, sich vom Mythos der „moralischsten Armee der Welt“ zu verabschieden. Es ist einfacher, sich gegen Feindbilder zu vereinen, die die demokratischen Werte einer liberalen, säkularen Gesellschaft unter Beschuss nehmen. Und das sind heute leider die Vertreter einer Autokratie unter Netanjahu, und die offen frauenfeindlichen und homophoben Siedler und Rabbiner.
Ausgabe bestellen