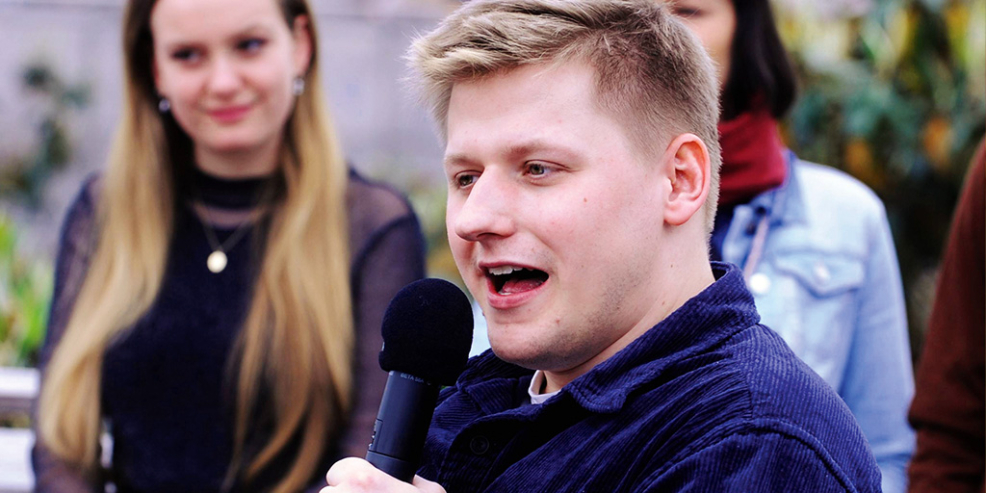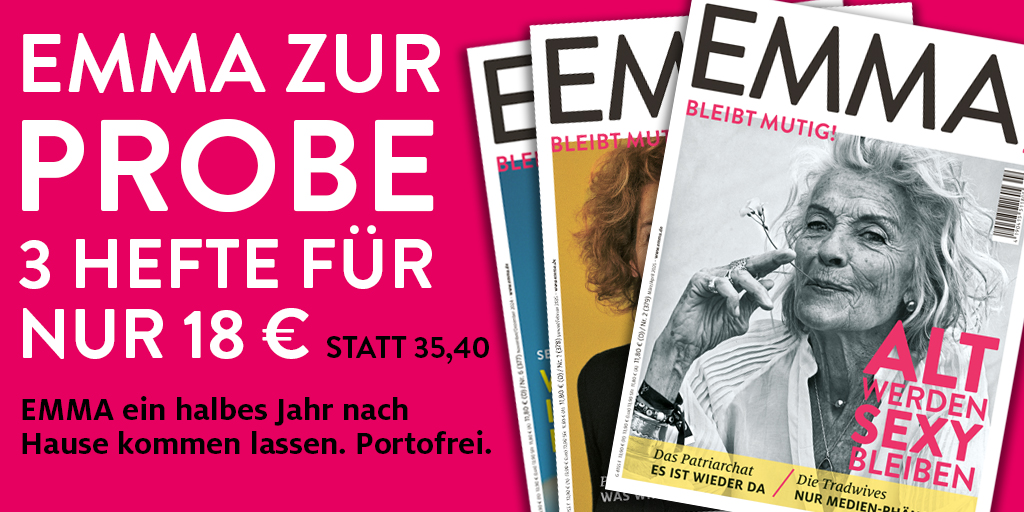Junge woke Männer: Der Fall El Hotzo
Sich als „modernen“ Mann zu präsentieren, ist heute ein Erfolgsmodell. Man ist stets gerngesehen, wird zu Talkshows und Interviews eingeladen und erzählt dort, was andere von einem erwarten. Man kritisiert andere Männer für ihr moralisches Fehlverhalten und signalisiert, dass man selbst ein toller Hengst ist, moralisch fehlerfrei und für die richtigen Werte einsteht: „Wir müssen die patriarchalen Strukturen aufbrechen“, „Es gibt so viele Männer, die Frauen schlecht behandeln“. Man erklärt, dass man als Mann Privilegien hat – und verurteilt diese beschämt. Man will nicht nur feministisch handeln – sondern vor allem zeigen, dass man feministisch handelt. Männer, die sich als progressiv sehen, tun das besonders gern dort, wo andere es sehen können.
Und jetzt, auweia, ist der moderne Mann doch nicht so moralisch perfekt, wie die Frauen ihn gern hätten und er bisweilen vortäuscht zu sein. Immer wieder kommen Fälle an die Öffentlichkeit: In Amerika verklagt gerade Blake Lively den Vorzeigefeministen und Schauspieler Justin Baldoni wegen sexueller Belästigung, in seinem „Man Enough Podcast“ diskutierte er gern über toxische Männlichkeit (es gilt die Unschuldsvermutung); schon Harvey Weinstein lief demonstrativ am Frauenmarsch mit.
In Deutschland trifft es den Satiriker und Autor Sebastian Hotz alias El Hotzo, der schon für Jan Böhmermann Witze geschrieben hat. Hotz positioniert sich öffentlich gegen soziale Ungerechtigkeit, er hat einen Roman geschrieben, in dem es um toxische Männlichkeit geht. Donald Trump wünschte er auf X den Tod, Thomas Gottschalk nannte er einen ekligen Freak, er verspottet auch mal Männer, die seiner Meinung nach keine Persönlichkeitsentwicklung durchlaufen haben. Dann kam sein Geständnis: „Ich war in den letzten Jahren in Beziehungen wiederholt untreu und habe anschließend meine Taten in immer komplizierter werdenden Lügenkonstrukten vertuscht und die Glaubwürdigkeit meiner Ex-Partnerinnen diskreditiert. Ich habe gelovebombt, gegaslighted, manipuliert und von Exklusivität gesprochen, Frauen hingehalten und Beziehungen verheimlicht, um nicht aufzufliegen. Ich habe damit meine Position und mein Image als reflektierter Medienmann ausgenutzt und damit viele verletzt.“ Offenbar unterhält er nicht nur ein verkrampftes Verhältnis zur Ehrlichkeit; er war rücksichtslos und destruktiv.
Das Liebesleben eines Satirikers geht mich ja nichts an. Das Problem beginnt dort, wo man Leute an einem anderen moralischen Maßstab misst als sich selbst. So verflixt es ist: Man muss sich an den Prinzipien messen lassen, für die man öffentlich einsteht. Das Motto „Regeln für dich, aber nicht für mich“ entlarvt dich als scheinheiligen Doppelmoralisten. Dieser verpackt sein Verhalten zwar hübsch. Doch am Ende ist nicht entscheidend, mit welch gepflegten Worten man sich positioniert oder ob man Pronomen fachgerecht verwendet, sondern was man tatsächlich tut, auch wenn die glänzende Fassade heute leider oft höher gewichtet wird.
Mit dieser kuriosen Gewichtung wurde die Nachfrage geschaffen, wie moderne Männer heute sein sollen. Maßgeblich daran beteiligt sind die Medien, allen voran die vielen jungen, in den Redaktionen tätigen Feministinnen. Sie beeinflussen, welche Verhaltensweisen und Werte bei Männern positiv dargestellt werden (Sensibilität, feministische Werte) und welche nicht (Streben nach Wettbewerb, stark ausgeprägter Ehrgeiz). Mit ihrer rosagefärbten Perspektive prägen sie Geschlechterthemen und auch, wie wir Männer heute sehen.
Die Inszenierung als moderner Mann ist also kein Zufall. Dieser Typus passt sich wie ein Chamäleon an, stets bestrebt, den gerade aktuellen gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen. Im Gegensatz dazu steht der „alte, weiße Mann“ (dabei geht es nicht um Alter oder Hautfarbe, sondern um das Modell traditioneller männlicher Werte), der heute oft verteufelt wird. Tatsächlich ist er weder politisch korrekt, noch kommuniziert er perfekt, zeigt sich nicht immer sensibel und denkt nicht ständig über seine Gefühle nach, auch er betrügt und verletzt. Doch gerade in seiner Unvollkommenheit liegt ein entscheidender Vorteil: Er erhebt sich moralisch nicht unablässig über andere. Er stellt sich nicht als etwas dar, das er nicht ist. Vielleicht ist das ja das neue, alte Erfolgsmodell.
Der Text erschien zuerst in der Schweizer Weltwoche.
Ausgabe bestellen