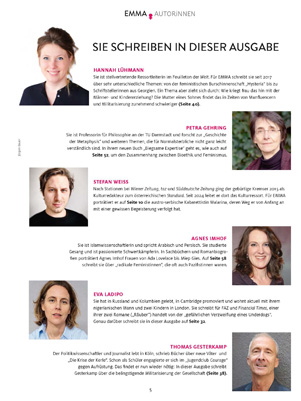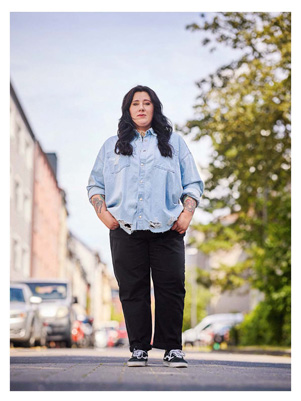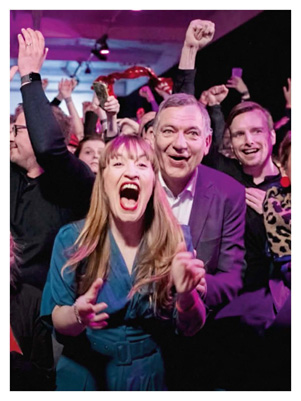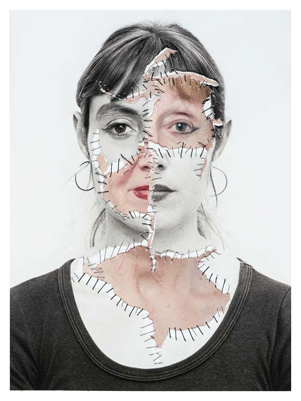Männerpreis für Finn Canonica: Mütter
Alle Welt spricht über die Sorgen berufstätiger Mütter. Väter dagegen werden mit ihren Problemen alleine gelassen. Höchste Zeit, ihnen mal zuzuhören.
Nick wollte unbedingt Vater werden. Mit zweiunddreißig war er ja auch schon in einem Alter, in dem man sich bereits freut, wenn man noch an eine Party eingeladen wird; man muss gar nicht mehr unbedingt hingehen. Auch sehnte er sich nach einem Hort der Geborgenheit, in den sich ein gehetzter, globalisierter Mensch wie er verkriechen kann wie in ein warmes Futteral. Warum also nicht eine Familie gründen? Und hatte nicht Lisa bereits am ersten Abend gesagt, dass sie mal Kinder will?
Vierzehn Monate später war Sohn Gabriel da.
Ein Neugeborenes verändert ein Leben mit der Wucht einer Naturkatastrophe. Kein Tag, den es fortan nicht bestimmen wird durch sein Geschrei, die kleinen und grossen Wehwehs. Mit diesem winzigen Eindringling im Leben eines Paares sind sämtliche Utopien und Lebenslügen wie weggewischt. Das wissen selbst Leute, die keine Kinder haben. Es heisst: Wenn Liebende diese erste Phase überstehen, ohne sich psychisch massakriert zu haben, stehen die Chancen gut, dass die Beziehung hält.
Inzwischen ist Nick seit einem knappen Jahr Vater. Er erzählt aus seinem Leben, und am Ende ist er so erschrocken wie jemand, der sich die Nase putzt und einen großen Klumpen Blut im Taschentuch findet. "Ich habe mir lange eingeredet, dass alles gut ist", sagt er, "bis ich plötzlich merkte, wie unglücklich ich eigentlich bin."
Möglich, dass Nick bloß überfordert ist, ein junger Mann aus der Nur-keine-Verantwortung-übernehmen- für-nichts-und-niemanden-Generation vielleicht. Wer sich jedoch mit jungen Vätern unterhält, stellt fest, dass viele so oder ähnlich fühlen. Frauen wissen in der Regel, was mit der Mutterschaft auf sie zukommt. Spätestens, wenn der feine blaue Strich im Fenster des Plastikstäbchens zu erkennen ist, beschäftigen sie sich damit. Sie tauschen sich mit ihren eigenen Müttern und Freundinnen aus, fragen Hebammen und Ärzte, lesen Fachbücher und Frauenmagazine oder suchen Rat in Internetforen.
Vater werden dagegen, ist eine einsame Sache. Selbst mit den besten Freunden wird noch eher über die Vor- und Nachteile einer EU-Mitgliedschaft geredet als über die Sorgen und Nöte, die einer als Vater hat.
"Keinen Stress mit dem Baby?" - "Geht so." Geht so. Das ist, unter Kumpels, die stets gültige Antwort.
Mit den Ratgebern für junge Mütter könnte man einen Winter lang heizen, die Vaterbücher reichten kaum für einen Tag. Und die paar wenigen stammen erst noch von jener Sorte Mann, die sich Frauen nur auf Knien nähert. Kein Wunder, lesen sie sich wie Pflichtenhefte für Dienstboten: "Achten Sie darauf, dass die Wohnung sauber bleibt!" - "Gehen Sie öfter mal Einkaufen!" - "Kochen Sie Ihr Lieblingsgericht!" In einer eigens für Männer konzipierten Broschüre einer Hebammenschule können Männer nachlesen, wie man seine schwangere Frau massiert. Oder wie man sie beim Stillen unterstützt. Lauter tolle Tipps – die in erster Linie der Mutter dienen.
Eine Freundin erzählte, ihr Mann sei kurz nach der Geburt seines Sohnes für zwei Tage abgehauen, allein auf einen Berg geklettert. Er hatte eine Art Vaterschock erlitten und brauchte die Zeit, um mit der Situation klarzukommen.
Die Vaterschaft ist für jeden Mann ein Phantasma am fernen Horizont. Bis zum Tag X. Ende der Schwangerschaft, rien ne va plus. Männer sind ein Drittel ihres Lebens Liebhaber oder Muttersöhne oder beides. Dann durchschneiden sie eine Nabelschnur und sind Vater.
"Ich starrte auf diesen kleinen, faltigen Wurm und hatte nur noch Angst", erinnert sich Nick an seine ersten Minuten als Vater.
Rückblickend waren für ihn die ersten Wochen dennoch eine schöne Zeit. Trotz kurzen Nächten und der immerwährenden Angst, der Kleine könnte eines Morgens tot in seinem Bettchen liegen. "Lisa und ich funktionierten ohne große Absprache, jeder tat, was er gerade konnte", sagt er. Er ist ein sanfter Mann, der beim Reden immer an die Decke schaut, als hingen seine Worte dort an einem Mobile. Manchmal bindet er sich eine dicke Krawatte um, das verlangt sein Job als Sales Assistant. Sein Familienbild stammt dennoch nicht aus den Fünfzigerjahren. Die ersten vier Wochen blieb Nick zu Hause. Vaterschaftsurlaub sozusagen. Dann ging er zurück ins Büro.
"Lisa und ich hatten schon vor der Geburt abgemacht, dass ich weiterhin hundert Prozent arbeiten würde", sagt er. Nick ist weder naiv noch dumm. Er wusste, dass er künftig eine Frau, ein Baby und einen Chef glücklich machen musste. Aber egal. Er wollte zeigen, was er drauf hat. Die Sache durchziehen. Professionell. "Es tönt lächerlich, doch ich fühlte mich zum ersten Mal wie ein erwachsener Mann." Außerdem werde man von der Biologie gesteuert. "Du steigerst dich in diese Ernährerrolle hinein, fühlst dich verantwortlich, willst so viel Geld wie möglich verdienen und gleichzeitig viel zu Hause sein."
Das klingt nach Selbstüberschätzung, aber man muss ihn verstehen. Nick ist nicht mit einem Silberlöffel im Mund auf die Welt gekommen. Und Lisa sei, sagt er, was Materielles betrifft, zwar nicht Paris Hilton, aber auch nicht gerade Mahatma Gandhi. "Ich wusste von Anfang an, dass ich dieser Frau auch etwas bieten muss."
Gabriel ist gerade zwei Monate alt, als der Arzt bei Lisa eine leichte Wochenbettdepression diagnostiziert. Sie kommt mit dem Stillen nicht klar, hasst ihren Körper, sagt, sie fühle sich wie ein Stück Schwemmholz. Er sagt ihr: "Du bist die attraktivste Mutter der Welt", macht ihr Geschenke, begehrt sie. Einmal verfrachtet er Gabriel kurzerhand zu den Grosseltern und fliegt mit Lisa übers Wochenende nach Paris.
Wenig später beginnt Lisa, Nick ständig im Büro anzurufen. Am Anfang geht es um Bagatellen: Kinderarzttermine, Elterngequake, wer kauft was, wann ein. Später findet sie, er würde sich zu wenig um die Familie kümmern. "Ich kann Lisa verstehen", sagt er, "den ganzen Tag alleine mit dem Kind, aber ich kann nicht immer um fünf nach Hause, niemand im Büro macht das."
Die dann folgenden Vorwürfe sind Klassiker: Mal ist die Wohnung zu klein (95 Quadratmeter), dann das Auto (VW Golf), dann Nicks Lohn (100.000 Schweizer Franken brutto im Jahr). Auf einem Spaziergang treffen die beiden ein befreundetes Paar, ebenfalls mit Baby. Und mit Bugaboo. Der Bugaboo, muss man wissen, ist statusmässig so was wie der BMW X5 unter den Kinderwagen – und deshalb für Zürcher Szenenmamis ein absolutes "must have". Verglichen damit, lag Gabriel in einem zwanzig Jahre alten VW Passat. "Den ganzen Abend musste ich mir anhören, was für eine blöde Idee es gewesen ist, auf Ebay diesen Schrotthaufen von einem Kinderwagen zu ersteigern", sagt Nick.
Einen Tag später kauft er einen froschgrünen Bugaboo. Lisa ist glücklich, aber nicht lange. Als er nach einem Kundenessen um ein Uhr in der Früh nach Hause kommt, lässt sie den Schlüssel stecken, so, dass er nicht mehr in die Wohnung kann. "Vielleicht war ich zu lange weg", sagt Nick, "aber solche Abende gehören zu meinem Job."
Das Unglück, sagt Nick rückblickend, sei langsam eingedrungen in sein Leben. Und als es dann unübersehbar wurde, hatte er das Gefühl, als sei es schon immer dagewesen. "Nichts stimmte mehr zwischen uns", erzählt er. Er verstehe ja, Mutter sein, ist ein Vollzeitjob. "Aber es ist auch nicht easy, abends völlig fertig nach Hause zu kommen, wo dir deine ebenfalls völlig fertige Frau ein schreiendes Baby in die Arme drückt und sagt, jetzt mach mal du."
Und je mehr er sich unter Druck fühlt, je schneller das Karussell der Schuldgefühle in seinem Inneren seine Runden dreht, desto mehr zieht er sich zurück. Er ertappt sich dabei, wie er den Nachhauseweg verzögert, Kollegen trifft, etwas Überflüssiges kauft. Die ersten Minuten zu Hause sind immer die schlimmsten.
"Wo warst du so lange?" - "Hast du diesen Hort jetzt mal angeschaut?" - "Kannst du Gabriel am Samstag zu meinen Eltern bringen?" - Die simpelsten Fragen seiner Frau werden zu Granaten.
Lisa fordert materiell von ihm den Himmel und verordnet ihm gleichzeitig die Hälfte der Betreuungsarbeit. Und weil das kein Mann schafft, der nebenbei noch eine Menge Geld verdienen muss, wird ständig gestritten.
"Vielleicht merkt Lisa gar nicht, wie sehr ich mich um diese Familie bemühe", sagt Nick. Sein Selbstvertrauen ist jedenfalls mächtig angeschlagen. Ein gemeinsamer Versuch, über ihre Probleme zu sprechen, endet in einem Desaster. Geschrei und Türengeknalle das ganze Wochenende. Und jetzt? Wie raus aus dem Psychosumpf? Er weiss es nicht. Er ist dick geworden in den letzten Monaten, er hat wieder mit dem Rauchen begonnen, und weil alles so kompliziert ist, bestellt er noch ein großes Bier.
"Das Schlimmste", sagt er schließlich, "ist das Gefühl, an meinen eigenen Ansprüchen gescheitert zu sein."
Wie Frauen Erfolg im Beruf mit einer Mutterexistenz verbinden können, hat schon ungefähr eine Million Podiumsdiskussionen beschäftigt. Von allen Seiten vernimmt man das Mamagerede, die endlosen Erörterungen von Stress und Schuldgefühlen, unter denen berufstätige Mütter leiden würden. Wie ein Mann mit dieser Doppelbelastung leben soll, muss er schon selbst wissen.
"Wenn du dich bei einer Frau darüber beklagst, wirst du gleich in die Supermacker-Ecke gedrängt", sagt Nick. Der Gedanke, dass Lisa in ihren Ansprüchen vielleicht zu weit geht, ist ihm vorerst gar nicht gekommen. Als eine Art heilige Kühe sind Mütter im öffentlichen Diskurs unangreifbar.
Umso schicker ist es, gegen Männer und damit auch gegen Väter zu sein. Das Ressentiment gegen Männer gehört zum kulturellen Mainstream. Man hat sich daran gewöhnt, dass Männer in Filmen, Zeitschriften und Werbung oft als schwanzgesteuerte und beziehungsunfähige Wesen porträtiert werden. Eine Kampagne des eidgenössischen Gleichstellungsbüros zeigte das Bild einer WC-Schüssel mit Klobürste. Darunter prangte der Spruch: «Immer mehr Männer hinterlassen zu Hause saubere Spuren." Der gestresste, inkompetente Mann ist ein beliebtes Komödien-Motiv.
Martin Lüthi aus "Lüthi und Blanc" ist das Paradebeispiel eines solchen Vaterbildes. Und viele Männer beteiligen sich selber an vorderster Front an dieser Selbstdenunziation. In Männermagazinen lebt der Mann unverdrossen als busen- und motorengeiler Neandertaler weiter. Die Kolumnenseiten von Frauenzeitschriften sind gefüllt mit Texten, in denen Männer zur Belustigung der Leserinnen tölpelhafte Geschichten aus ihrem Leben erzählen.
Die ständig wiederholten Behauptungen, schreibt die feministische Philosophin Elisabeth Badinter in ihrem Buch "Die Wiederentdeckung der Gleichheit", dass Frauen weniger kriegerisch und mehr um andere besorgt sind als Männer, hätten ein zur Karikatur verzerrtes Männerbild geschaffen. Kein Wunder, interessiert sich in einem solchen Klima kein Mensch für die Sorgen von Vätern.
Als Lisa Nick neulich während eines Streites sagte, sie brauche ihn noch drei Jahre, dann sei sie mit dem Kind aus dem Gröbsten raus, könne sich dann einen anderen suchen, schloss er sich in sein Büro ein und heulte los.
An dieser Stelle müssten jetzt die Experten zu Wort kommen. Eine Therapeutin zum Beispiel. Sie würde Nick in einem hübschen Zimmer empfangen, warme Farben, vielleicht ein paar Kinderzeichnungen an der Wand. Sie würde möglicherweise sagen, dass solche Krisen ganz normal seien, und dass viele Väter am Anfang Probleme hätten. Oder sie erklärt die Situation zu Hause mit seiner Unfähigkeit, sich von alten Rollenmustern zu lösen. Gut möglich, dass sie dann ungefähr Folgendes sagen würde: "Es reicht nicht, wenn ein Mann sagt, er wolle sich an der Haus- und Erziehungsarbeit beteiligen. Er muss auch bereit sein, weniger zu arbeiten."
Andreas ist so ein "neuer Mann". Es ist nachmittags um drei. Er sitzt in seiner krümelfreien Küche und starrt durch seine dicken Brillengläser, die seine müden Augen riesengross machen, in eine Tasse Tee. Er beginnt jeden zweiten Satz mit der Formulierung: «Als Hausmann und Vater...» Die zweijährige Annouk schläft. An der Wand hängen die Listen seiner Frau. Wer wann was und wie erledigen muss im Haushalt und für wie lange, alles mit dickem Filzstift fein säuberlich notiert. Auf eine Vollzeitstelle als Lehrer in einem Berner Gymnasium hat er freiwillig verzichtet. Aus Solidarität zu seiner Frau, einer Verlagslektorin.
"Ich mache das gerne", sagt er. "Sandra stellt materiell auch keine hohen Ansprüche an mich." Umso wichtiger sei es ihr gewesen, dass die Haushalt- und Erziehungsarbeiten gerecht aufgeteilt würden. Gerecht heisst, jeder erledigt die Hälfte der Hausarbeit. Andreas lässt jeden durchschnittlich emanzipierten Mann aussehen wie den Playboy Porfirio Rubirosa: Er wickelt, badet, wiegt, kocht, wäscht, putzt, kauft ein, bemuttert und tröstet. Und er findet das alles ganz okay, bis vor kurzem jedenfalls.
Der Dämon schlich sich in Form eines einzigen Satzes in die Wohnung. Nun schlängelt er sich durch den Alltag der Eheleute, wetzt nachts sein schärfstes Messer. Der Satz lautete: «Ich liebe dich als Hausmann, erotisch finde ich dich in dieser Rolle aber nicht mehr.» Er sei seiner Frau irgendwie rausgerutscht, sagt Andreas leise. Er hockt jetzt wie eine Qualle im Sessel, kratzt seinen Bart – fast kann man seine Frau verstehen.
Wenigstens ist ihm jetzt klar, weshalb der letzte Sex schon vierzehn Monate her ist. Weshalb er vergessen hat, wann sie sich das letzte Mal richtig geküsst haben. Weshalb er regelmässig ein bisschen ausflippt, wenn etwas nicht so läuft, wie er will. Wobei nicht der sexuelle Notstand sein grösstes Problem ist. Es geht um Grundsätzlicheres. Er klingt jetzt wie nach einem Männerworkshop, nach einer Woche trommeln in den Wäldern: "Es geht um meine männliche Identität", sagt er. Und: "Ich fühle mich als Mann nicht mehr ernst genommen." Irgendwie könne er ja verstehen, dass ein Mann, der den ganzen Tag Babysprache spricht, in Pantoffeln durch die Wohnung wetzt und nach Kinderkacke riecht, die Libido einer Frau nicht in Wallungen versetzt, "aber diese Rollenaufteilung wollten wir beide".
Seit seine Frau ihn mit diesem einen Satz kastriert hat, beurteilt er den Medienhype der letzten Jahre um die so genannten neuen Väter skeptisch: "Der Preis, den ein Mann dafür bezahlt, wurde nie diskutiert." Jetzt redet er von sich selbst, von der Frustration eines Mannes, der aus weiblicher Sicht zwar ein toller Vater ist, als Sexobjekt aber scheintot. Und je länger er über seine Lage nachdenkt, desto klarer wird ihm, dass alle theoretischen Überlegungen am Ende in einer einzigen Frage münden: Was macht eigentlich einen guten Vater aus?
Zumindest für Kinder ist das eine kinderleichte Frage. Die neunjährige Vera und der sechsjährige Matteo, zwei Kinder von Freunden, antworten: "Er muss für mich da sein, wenn ich ihn brauche." - "Mein Vater muss immer lieb sein." - "Wenn ich krank bin, möchte ich, dass er mich pflegt." - "Ich will von ihm viele Geschenke." - "Er kann mir bei den Aufgaben helfen." - "Er muss mich vor meinem Bruder beschützen." - "Mein Vater muss mit mir spielen am Abend." - "Ich will, dass er mir einen Hund kauft."
Die Antworten der Kinder weisen in eine bestimmte Richtung: Offenbar gibt es keine grossen Unterschiede mehr bezüglich der Erwartungen eines Kindes an Vater oder Mutter. Oder doch?
Als der Vater in Peter Handkes "Kindergeschichte" das Neugeborene zum ersten Mal sieht, heisst es: "Es war nicht bloss Verantwortung, was der Mann beim Anblick des Kindes fühlte, sondern auch Lust, es zu verteidigen, und Wildheit: die Empfindung, auf beiden Beinen dazustehen und auf einmal stark geworden zu sein."
Gewiss, ein Vater muss sein Kind verteidigen können, so wie Tom Cruise als Vater in "Krieg der Welten" sein Leben riskiert, um Sohn und Tochter vor den Attacken Ausserirdischer zu bewahren. Und was sonst noch? An was erinnern sich erwachsene Männer, wenn sie an ihre Väter denken? Was war das Wichtigste, was einem der eigene Vater mitgegeben hat?
Am besten, man fragt in seinem Freundeskreis nach. Was auffällt ist, wie banal oder pathetisch manche dieser Geschichten sind. In vielen Erinnerungen tauchen die Väter als tragikomische Gestalten auf, als eine Mischung aus Grand Guignol und Tyrann. "Ich erinnere mich", erzählt ein Freund, "wie mein Vater mir mal feierlich im Zug gezeigt hat, wie man eine Zeitung so faltet, dass man sie mit einer Hand lesen kann." Ein anderer: "Er gab mir einen einzigen Satz mit auf den Weg: Wenn du schwul bist, mache ich dich kaputt." Noch ein anderer: "Ich erinnere mich an den grossen Löffel, der während des Essens immer in meine Richtung geflogen kam." Oder: "Er konnte zu meinem grossen Vergnügen auf Kommando furzen." Nick: "Im einzigen wirklich persönlichen Gespräch, das mein Vater je mit mir geführt hat, erklärte er mir, warum er meine Mutter verlassen hat."
Es gab Zeiten, da war ein Vater eine Art Gott auf Erden und der Mittelpunkt einer möglichst grossen Familie. Ein Vater musste stark, dominant und gerecht sein. War er dazu noch tyrannisch und jähzornig, gehörte das irgendwie zu seiner Rolle. In der Not tauchte er im richtigen Moment auf und beseitigte, was die Familie bedrohte. Er war eine autoritäre Führergestalt wie John Wayne. Oder Churchill. Oder de Gaulle. Als kleiner Junge war man überzeugt davon, dass der eigene Vater eine Rakete zum Mars steuern kann. Als kleines Mädchen wollte man ihn heiraten. Keine normale Frau wünschte sich ihren Mann bei der Geburt bei sich. Es war die Zeit, als Väter die entscheidenden Stunden rauchend vor der Tür des Gebärsaals verbrachten und den Schwestern auf den Hintern guckten.
"In der bürgerlichen Familie, die sich durch die innere Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau bestimmte", schreibt der österreichische Philosoph Konrad Paul Liessmann in einem Essay über das Verschwinden der Vaterfigur, "repräsentierte der Vater die Außenwelt, die Gesellschaft und ihre bestimmenden Mechanismen: Geld, Gott und Gesetz. Die Mutter repräsentierte demgegenüber die Intimität und das Interieur."
Das lange Zeit dominierende Bild des bürgerlichen Haushalts zeigt eine Familie bei Tisch. Die Mutter ist immerzu darauf bedacht, dass alle Teller gefüllt sind, während der stets Krawatte tragende Vater in langen Monologen seinen Kindern die Welt erklärt.
Heute ist die klassische Vaterrolle nicht mehr gefragt. Was vom alten Vaterbild noch übrig geblieben ist, erledigte die feministische Kritik.
Die "Vaterlose Gesellschaft", wie sie der Soziologe Alexander Mitscherlich Anfang der Sechzigerjahre voraussah, ist Realität geworden. Der durchschnittliche Vater ist zum Glück kein Halbgott mehr, sondern ein verständnisvoller Pädagoge, der die Hälfte von dem, was seine Kinder im Teenageralter erzählen, gar nicht mehr versteht.
Spätestens das Informationszeitalter hat dafür gesorgt, dass Jugendliche heute über viele Dinge besser Bescheid wissen als ihre Väter. Sie sprechen in der Regel mehr Sprachen und beherrschen neue Technologien besser. Sie haben ein feineres Gespür für den Zeitgeist und bewegen sich mit Leichtigkeit durch Länder, in denen ihre Väter noch nie gewesen sind. "Keinem Heranwachsenden, der sich auf der Höhe der Zeit bewegt", schreibt Konrad Paul Liessmann, "würde es einfallen, seinen Vater zu fragen, was sich in der Welt so tut."
Das Modell der so genannten partnerschaftlichen Familie hat sich mehr und mehr durchgesetzt, die Differenz zwischen Vater- und Mutterrolle wurde verwischt. Väter sind – wie Andreas – Männer, die perfekt in die Rolle der Mutter schlüpfen können. Und Mütter legen ebenso wie Väter darauf Wert, neben der Hausarbeit noch berufstätig zu sein.
So sieht es in vielen Familien am Ende eines langen gesellschaftlichen Auflösungsprozesses aus.
Theoretisch ist das alles wunderbar. Praktisch sieht es in vielen modernen Familien nicht ganz so harmonisch aus. Das Verneinen jeder Differenz zwischen Vater- und Mutterolle hat zu neuen, unerwarteten Konflikten geführt. Die zentrale Frage ist jedoch offen geblieben: Wie funktioniert eine moderne Familie am besten?
"Ich hatte dieses idyllische Bild vom Leben zu dritt im Kopf", sagt Cédric: "Ferien in Frankreich, eine Sommerwiese, Kerstin und ich lieben uns, während unser Baby neben uns schläft." Das war noch während der Schwangerschaft seiner Frau. Er erzählt Fetzen aus seinem Vaterleben: Tochter Carlotta ist acht Monate alt, ein Wunschkind, ihre Mutter ist Architektin.
Es spricht ein gut aussehender, 36-jähriger Mann, dem es im Gesicht geschrieben steht, wie schwer es ihm fällt, auf Frauengeschichten zu verzichten. Er trägt ein schmal geschnittenes Hemd und Parka, keine Turnschuhe. Trotz Vaterschaft hat er die Stilhoheit nicht abgegeben. Zum Aufwärmen berichtet er von den üblichen Problemen: Es gibt keine freie Minute mehr. Es wird nur noch übers Kind geredet. Das Geld wird knapp, der Sex schlecht.
"Alles Peanuts, wenn dein Kind lacht, ist alles vergessen", sagt er mit typischem Jungvaterstolz. Was ihn hingegen quält, richtig depressiv macht, ist das Gefühl, ausgeschlossen zu werden aus dem Idyll zwischen Mutter und Kind. "Manchmal schiebt meine Frau ganz unbewusst meine Hand weg, wenn ich Carlotta streicheln will", erzählt Cédric.
Auch er hat Remo Largos Klassiker "Babyjahre" gelesen. Er wusste, dass der Säugling sich erst mal nur für die rote Zielscheibe der Mutterbrust interessiert. Das Gefühl, nicht dazuzugehören, hat ihn dennoch umgehauen. "Die leibliche Innigkeit von Mutter und Kind während Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit liess mich als Zaungast weit aussen vor", schreibt der Zürcher Psychiater Berthold Rothschild stellvertretend für viele Väter in einem wunderbaren Text über seine eigene Vaterschaft.
Cédric sagt: "Was immer ich mit Carlotta anstelle, in den Augen meiner Frau ist es falsch." Jeden Abend zum Beispiel, wenn er nach Hause kommt, "nur schon ihr Blick, als ob ich ein Fremder wäre". Er wisse im Grunde ja, sagt Cédric, dass sie es nicht so meine, aber phasenweise fühle er sich zum Hilfspfleger degradiert. Wenn sie auf dem Sofa sitzt und die Kleine stillt, und er sich entspannen will, lesen oder TV schauen, geht es los: "Machst du einen Tee?" - "Bringst du die Vitamine?" - "Holst du ein Tüchlein?" - "Bringst du mir bitte mein Handy?" Dieser sanfte Befehlston, sagt er, treibe ihn in den Wahnsinn.
Und wenn er Carlotta in den Arm nimmt, immer lässt sie diese Bemerkungen über seine Vaterqualitäten fallen. "Pack sie nicht zu warm ein!" - "Kopf stützen!" - "Riechst du denn nichts?" Lauter Sätze, die ihn in den Rückzug treiben.
"Mehr und mehr fühle ich mich als Vater nicht ernst genommen", sagt Cédric. Und spricht damit aus, was Männer erleben, die sich vom Bild des Vaters als blosser Ernährer verabschiedet haben und sich wie eine Mutter engagieren wollen: Viele Frauen klammern sich an ihrem Bemutterungsmonopol fest wie der klassische Bürohengst an seinem USM-Haller-Schreibtisch.
In der Schweizer Männerzeitung männer.be beschrieb ein Mann den Versuch, sein schreiendes Baby im Zug zu beruhigen. "Ich hatte sie im Arm, da fragt mich eine Frau, ob ich sie ihr geben wolle – wohl in der Meinung, eine fremde Frau sei immer noch besser als der Vater."
Wie weiter? Sollen sich Väter mit solchen Erfahrungen jetzt etwa zu einer Vaterbewegung zusammenraufen, um gegen diese glorifizierte Mutterwelt anzukämpfen, in der Väter kein Thema sind? Unsinn. Geschlechtersolidarität ist ein naiver Traum.
Nicht einmal Andreas glaubt daran. "Männer sind verschieden, Frauen auch", sagt er. Seiner Meinung nach braucht es statt eines Mutterschaftsurlaubs einen Elternschaftsurlaub wie in den skandinavischen Ländern. Außerdem sollte der Staat Eltern belohnen, die die Kinderbetreuung partnerschaftlich organisieren. "Nur so wird die Vaterschaft künftig von der Gesellschaft besser respektiert werden", sagt er.
Nick hat sich den Bestseller "Making Marriage (like) Work" des amerikanischen Psychiaters Scott Haltzmann gekauft. Haltzmann behauptet, Beziehungen scheitern, weil Frauen wollen, dass Männer über ihre Ängste reden. Das sei gegen die männliche Natur. Männer, so Haltzmann, sind tief im Herzen alle Soldaten. Er empfiehlt eine Strategie der Selbstüberlistung: Ehe und Brutpflege, muss sich ein Mann nur lange genug einreden, sind wichtige militärische Missionen, deren Scheitern mindestens einen Weltkrieg auslöst.
"Es ist schon seltsam", sagt Nick, "ich habe mir ein Leben lang Mühe gegeben, kein Macker zu sein, und jetzt wird mir geraten, die Vaterschaft mit einer Art James-Bond-Attitüde anzugehen." Aber das Erstaunlichste sei, oh boy, es nützt.
Cédric hat vor ein paar Wochen seinen Vater besucht, einen pensionierten Arzt. Er wollte mit ihm über seine Familienprobleme sprechen. Vater und Sohn machten zusammen einen langen Spaziergang, sprachen über die Gesundheit der Mutter, Sport, Politik. Nach zwei Stunden berichtete Cédric seinem Vater endlich von seinen Problemen, dem Gefühl des Ausgeschlossenseins, der grossen Traurigkeit. Der Alte hörte ihm aufmerksam zu und sagte am Ende einen einzigen Satz: "So ist es halt, wenn man eine Familie hat."
Das Magazin, 18.3.2006