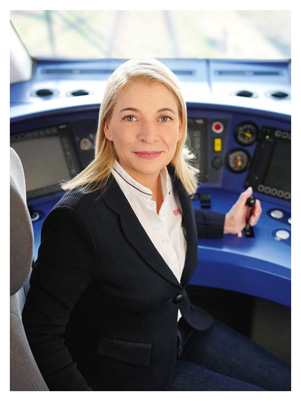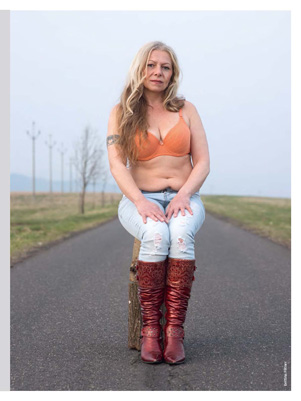Können Pflanzen sprechen?
Tiere in Gefahr fahren ihre Krallen aus, verstecken sich oder laufen davon. Pflanzen können das nicht. Trotzdem sind sie Bedrohungen nicht schutzlos ausgeliefert, sondern haben ihre eigenen Tricks und Strategien, um Feinde abzuwehren. „Wäre dem nicht so, gäbe es sie wahrscheinlich nicht mehr“, sagt der Biologe Dieter Volkmann, emeritierter Professor der Universität Bonn. Denn immerhin, so Evolutionsbiologen, sind die Pflanzen älter als Tier und Mensch.
Die Bohne lockt mit Nektar Bodentruppen an
Wie sich Pflanzen wehren, macht die Limabohne (Phaseolus lunatus) vor, deren Blätter sowohl bei Käfern und Heuschrecken wie auch Raupen beliebt sind. Könnten die, wie sie wollten, würden sie ihre Kiefer ständig ins saftige Grün der Pflanze schlagen. Doch das weiß die Bohne mit mehreren Methoden zu verhindern, zum Beispiel, indem sie durch den süßen Nektar der Blüten Bodentruppen anlockt. Es sind vor allem Ameisen, die zur Hilfe eilen und die lästigen Angreifer von den Blättern werfen.
Gegen die Raupen der Eulenfalter (Noctuidae) können die Ameisen allerdings nichts ausrichten. Dafür fährt die Limabohne ganz andere Geschütze auf und setzt auf Unterstützung aus der Luft: Sie kurbelt die Produktion von Signalstoffen an und gibt dann ein ganzes Bukett von flüchtigen Duftstoffen frei. Das lockt Schlupfwespen an, die in den Raupen ihre Eier ablegen, aus denen später Larven schlüpfen, die den Raupenkörper von innen auffressen. Wird die Limabohne dagegen von Spinnmilben angegriffen, ruft sie Raubmilben zur Hilfe.
Es ist der Speichel der Insekten, der der Pflanze verrät, mit wem sie es zu tun hat. Nur so kann sie die Duftgemische produzieren, die die passenden Helfer anlocken. Darauf reagieren auch die Nachbarpflanzen. Für sie ist der Hilferuf eine Warnung und sie aktivieren prompt ihre Stoffwechselwege für die Verteidigung, um gegen drohende Angreifer gefeit zu sein. Ganz ähnlich wie die Limabohne hält es auch die Akazie (Acacia collinsii), der Mais (Zea mays) und die Tomate (Solanum lycopersicum). Sie wehren und warnen sich. Könnten sie sprechen, ginge es laut zu auf den Wiesen und in den Wäldern.
Dass es sich bei dem Austausch zwischen Pflanzen und Insekten nicht nur um Abwehr und Krankheit dreht, ist schon lange bekannt. Denn auch der Duft, der von den Blüten der Pflanzen ausgeht, ist eine olfaktorische – also den Geruchssinn betreffende – Nachricht, die Insekten anlockt, vor allem Bienen. Die sollen die Pflanzen aber nicht beschützen, sondern bestäuben und bekommen im Gegenzug den süßen Nektar, aus dem später Honig entsteht.
Ein Duft-Signal. Dann sind auch
Nachbarpflanzen alarmiert
Pflanzen reagieren aber nicht nur auf chemische Signalstoffe, sie nehmen auch etwa 15 verschiedene Umweltfaktoren wahr. Darunter Temperatur, pH-Wert, Schwermetalle wie Blei und auch Licht. So können Pflanzen nicht nur die Richtung und Intensität des Lichts erkennen, sondern auch seine Qualität, also die Spektralfarben messen und sich so über die Position ihrer pflanzlichen Nachbarn informieren. Denn die schlucken sowohl rotes als auch blaues Licht. Daher unterscheidet sich das von ihnen reflektierte Licht von der direkten Sonneneinstrahlung. Die pflanzlichen Lichtrezeptoren erkennen diesen Unterschied, so dass die Pflanze dem Nachbarn ausweichen kann, bevor der sie in den Schatten stellt.
Fleischfressende Pflanzen und Mimosen sind ein Musterbeispiel für eine weitere Fähigkeit der sensiblen Wesen: Pflanzen reagieren auf Berührung. Fast zwanzig Jahre ist es mittlerweile her, dass Janet Braam von der Rice University in Houston die so genannten Berührungsgene entdeckte. Werden diese Gene aktiviert, ändert die Pflanze ihre Wachstumsrichtung. So wachsen junge Pflanzen, die regelmäßig gestreichelt werden, klein und buschig, während vernachlässigte Sprösslinge in die Höhe schießen. Diese Reaktion kann mitunter sehr nützlich sein. „Denn wächst eine Pflanze an einem windigen Standort, sind ihre Überlebenschancen größer, wenn sie ihre Gestalt dieser Umwelt anpasst“, erklärt Braam.
Ums Überleben geht es auch, wenn Pflanzen ihre Artgenossen erkennen und sie sogar von ihren eigenen Geschwistern unterscheiden. Die Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana) findet zum Beispiel anhand des Wurzelsekrets heraus, wer zur Familie gehört und wer nicht. Zählt der Nachbar nicht zur Verwandtschaft, werden ihm durch erhöhtes Wurzelwachstum möglichst viel Wasser und Nährstoffe abspenstig gemacht. Ist die Nebenpflanze dagegen aus einem Samen der eigenen Mutter gekeimt, breitet die Ackerschmalwand ihre Wurzel nur so weit aus, dass der Nächste auch noch genügend Platz hat.
Vernachlässigte Sprösslinge wachsen
in die Höhe
„Nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen bevorzugen ihre Verwandten“, erklärt Susan Dudley von der McMaster University Hamilton in Kanada. „Da sie teilweise die gleichen Gene haben, fördert ein solches Verhalten den genetischen Erfolg.“
Und damit nicht genug. Pflanzen haben zwar keine Ohren, doch die Membran ihrer Zellen ist auf ihre Art empfindlicher als das menschliche Gehör. Dass die sensiblen Wesen tatsächlich Töne registrieren, belegen mehrere Studien: Der Biologe Stefano Mancuso von der Universität in Florenz hat in einem toskanischen Weinberg gezeigt, dass Reben, denen regelmäßig klassische Musik vorgespielt wird, nicht nur seltener von Schadinsekten heimgesucht werden, sondern auch größere und süßere Früchte tragen als nicht beschallter Wein.
Und im Labor wies Mancuso nach, dass Wurzeln in die Richtung der Tonquelle wachsen. Warum, ist noch nicht ganz klar. Unklarheit herrscht auch darüber, weshalb junge Getreidepflanzen in Wasser ihre Wurzeln in Richtung einer regelmäßigen Geräuschquelle mit einer Frequenz von 220 Hz ausrichten, wie der italienische Forscher vor fünf Jahren zusammen mit einem internationalen Forscherteam zeigte.
Dass Pflanzen flüchtige Signalstoffe produzieren und oberirdische Warnsignale an ihre Nachbarn senden – wie im Fall der Limabohne – ist schon lange bekannt. Relativ neu dagegen ist, dass solche Botschaften auch unter der Erde kursieren: Etwa 90 Prozent aller Pflanzen leben in einer Symbiose mit so genannten Mykorrhiza-Pilzen. Das sind Wurzel-Pilze, die die Pflanzen mit anorganischen Mineralstoffen wie Phosphor und Stickstoff versorgen. Für ihr Entgegenkommen erhalten die Pilze Zucker, den die Pflanzen aus der Fotosynthese gewinnen. Der ganze Boden ist von den Pilzen durchwoben, die die Pflanzen über ihre Wurzeln miteinander verbinden. Wissenschaftler sprechen von einem „Wood Wide Web“ und vermuten, dass auf dem unterirdischen Marktplatz ein reges Treiben herrscht.
Forscher sprechen vom "Sozialismus
im Boden"
So hätten junge Bäume unter dem dunklen Kronendach eines Waldes kaum eine Chance, wenn sie nicht von den älteren Bäumen der gleichen Spezies mit Nährstoffen versorgt werden würden. Forscher sprechen von einem „Sozialismus im Boden“, und die unterirdische Leitung soll über 30 Meter weit reichen.
Es sind aber eben nicht nur Nährstoffe, die über das Pilzgeflecht ihren Weg finden, wie Forscher um David Johnson von der Universität Aberdeen im Jahr 2013 herausfanden. Die Wissenschaftler zeigten, dass sich Ackerbohnen (Vicia faba) nicht nur oberirdisch vor Blattläusen warnen, sondern auch über das unterirdische Mykorrhiza-Geflecht. Wie die Informationen genau von einer Pflanze zur anderen gelangen, ist bisher aber noch nicht bekannt. Die Wissenschaftler vermuten allerdings, dass auch hier chemische Signale im Spiel sind.
Auch wenn Pflanzen weder Augen und Ohren noch Neurone und Synapsen haben, nehmen sie ihre Umwelt sehr genau wahr und passen ihre Reaktionen entsprechend an. Bereits vor 30 Jahren vermutete Dieter Volkmann, dass Pflanzen sowohl sehen, hören, riechen als auch schmecken können. Damals wurde er von seinen Kollegen belächelt und kritisiert. „Jetzt ist es etwas ruhiger geworden“, meint der Biologe. Mittlerweile sind viele seiner damaligen Vermutungen experimentell belegt und immer mehr Wissenschaftler suchen eine ernsthafte und offene Diskussion zum Thema „Pflanzenkommunikation“.
„Natürlich kann man Pflanzen nicht mit Tieren in einen Topf stecken“, sagt Volkmann. Dennoch gibt es viele Gemeinsamkeiten auf molekularer Ebene. Zum Beispiel, dass es neben den Phytohormonen auch elektrische Signale in Pflanzen gibt. Wozu sie dienen, ist bislang noch wenig erforscht. Volkmann geht aber davon aus, dass sie ähnlich wie in tierischen Organismen Botschaften von Zelle zu Zelle weitergeben.
Übrigens sorgte noch vor etwa 80 Jahren die Vermutung, dass es in Pflanzen Moleküle gebe, die wie Hormone wirken, für Aufruhr und rigorose Ablehnung unter Wissenschaftlern. Und noch Anfang der 1970er Jahre war es verpönt, von „Pflanzenhormonen“ zu sprechen. Heute sind Phytohormone gut erforscht und in Expertenkreisen längst akzeptiert.
Pflanzen sind keine passiven Wachstums-
roboter
Eines haben Pflanzen und Tiere außerdem gemeinsam: Sie können sich den evolutionären Herausforderungen wie Wachstum, Konkurrenz und Vermehrung nicht entziehen. Und manchmal sind die Lösungen für die Probleme überraschend intelligent. Definiert man „Intelligenz“ im Sinne von Gedächtnis, Problemlösung und Vorausplanung, gesteht Volkmann selbst Pflanzen Intelligenz zu. „Jedes Lebewesen, das einen langen Weg in der Evolution hinter sich gebracht hat, sollte intelligent sein“, kommentiert der Biologe.
Die Forschungsergebnisse der letzten Jahre zeigen jedenfalls, dass die Fähigkeiten von Limabohne, Mais & Co sehr lange unterschätzt wurden. Und die jüngsten Entdeckungen lassen erahnen, dass die Welt der Pflanzen ein Dschungel voller Geheimnisse und Überraschungen ist. Denn Pflanzen sind eben keine passiven Wachstumsroboter, sondern kommunikative und sensible Organismen.
Peggy Freede
Weiterlesen
Stefano Mancuso/Alessandra Viola: Die Intelligenz der Pflanzen (Kunstmann);
Peter Wohlleben: Das geheime Leben der Bäume;
Hope Jahren: Blattgeflüster (beide Ludwig); Volker Arzt: Kluge Pflanzen. Wie sie locken, lügen und sich wehren (Goldmann);
Daniel Chamovitz: Was Pflanzen wissen. Wie sie sehen, riechen und sich erinnern (Hanser).