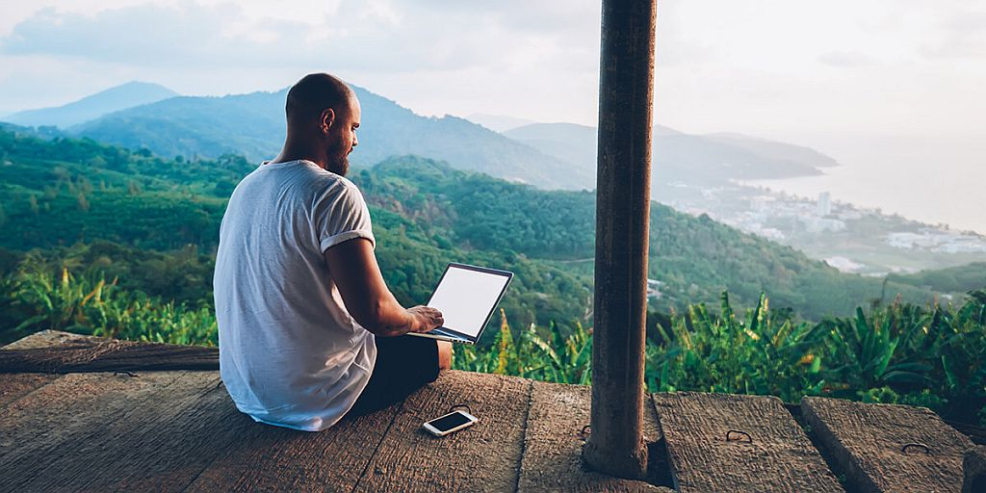Wehrdienst: Sie wollen nicht!
Sprechen wir einmal nicht über Langstreckenraketen, sprechen wir über das, was in einem Krieg das Allerwichtigste ist: Männer. Junge, gesunde Männer, die Kisten mit Artilleriemunition schleppen können, die mit gebuckelten schweren Maschinengewehren durch matschiges Gelände stapfen. Männer, die bereit sind, Frostnächte in einem Erdloch zu verbringen, kaltes Bohnenmus zu essen und mit vor Angst vollgeschissenen Uniformhosen durch einen Wald zu robben. Männer, die bereit sind, zu töten und getötet zu werden. Für alle Politiker und Generäle, die Kriege führen wollen oder müssen, sind solche Männer das kostbarste Gut, nicht Drohnen und Raketen.
Die jungen Männer sind viel gereist, sie würden bei Krieg sofort ins Ausland fliehen
Kostbar ist dieses Gut, weil es rar geworden ist. Das ist ein neues Phänomen, durch das sich unsere Zeit von allen früheren Zeiten unterscheidet. Sowohl 1914 wie 1939 und auch noch im Vietnamkrieg gab es auf beiden Seiten ein großes Reservoir junger Männer zweiter und dritter Söhne ihrer Eltern, die man im Gefecht opfern konnte, ohne der eigenen Wirtschaft dadurch irreparablen Schaden zuzufügen. Das ist nicht mehr so. Die Fertilitätsrate der Frauen ist in den vergangenen fünfzig Jahren sowohl in den USA wie in Russland und China dramatisch gesunken. In allen hochtechnisierten Staaten weltweit gibt es immer weniger junge Männer. Großoffensiven mit einer, sogar zwei Millionen Soldaten wie noch im Zweiten Weltkrieg sind heute für jede Großmacht reines Wunschdenken, um es zynisch auszudrücken.

Für die NATO-Staaten ist die Situation aber noch dramatischer, da in den westlichen Ländern gleich zwei schlechte Nachrichten zu vermelden sind: Nicht nur gibt es nur noch wenige junge Männer, sondern diese wenigen sind in der Regel auch noch gut ausgebildet und zu striktem Individualismus erzogen worden. Viele haben einen Universitätsabschluss, der ihnen auch im Ausland Chancen auf einen Job ermöglicht. Diese jungen westlichen Männer sind viel gereist, sprechen oft fließend Englisch, Französisch oder Spanisch. Sie sind geistig und physisch mobil, ihr Heimatgefühl erstreckt sich oft auf ganz Europa oder gar die ganze westliche Hemisphäre. Bei nicht wenigen erstreckt es sich auch auf Asien. Durch das Internet sind sie gut informiert über das, was in China, Japan oder Los Angeles vor sich geht, sie hören sich vielleicht auch den englischsprachigen Podcast eines russischen Historikers an. Aber vor allem sind sie oft die einzigen Söhne ihrer Eltern, wenn nicht gar das einzige Kind.
Wenn man Leute wie den sozialdemokratischen Nato-Generalsekretär Mark Rutte oder den in seiner schicken Uniform etwas operettenhaft wirkenden Nato-Admiral Rob Bauer in Talkshows über Unnachgiebigkeit gegenüber den Russen schwadronieren hört, könnte man denken, dass die Nato-Führung im Notfall nur auf einen Knopf zu drücken braucht, damit ein gepanzerter Storch zwei Millionen junge Männer über dem Nato-Hauptquartier abwirft, die begierig darauf sind, in der Ukraine gegen Russen zu kämpfen. Doch es gibt Studien und Umfragen, die ein realistischeres Bild der Wirklichkeit liefern.
Letztes Jahr gab die angesehene Deutsche Depeschenagentur eine Umfrage in Auftrag. Die Kernfrage lautete: Was würden Sie tun, wenn Deutschland militärisch angegriffen würde? Fast 25 Prozent der Befragten antworteten, sie würden ins Ausland fliehen. Es waren mehrheitlich junge Deutsche, die diese Antwort gaben. Eine ähnliche Umfrage in Großbritannien ergab, dass 38 Prozent aller unter 40-Jährigen sich im Kriegsfall weigern würden, in der britischen Armee zu kämpfen. 30 Prozent sagten, sie würden auch dann nicht kämpfen, wenn eine Invasion Großbritanniens unmittelbar bevorstünde. In den USA sieht es laut einer Umfrage von Yougov so aus: Stünde eine feindliche Invasion des amerikanischen Mutterlandes bevor, würden 16 Prozent der Befragten aller Altersgruppen sich freiwillig zur Armee melden. 47 Prozent antworteten, dass sie auch im Fall einer feindlichen Invasion nicht kämpfen würden.
Für jeden Ukrainer, der kämpft, ist einer ins Ausland geflohen
Solche Umfragen sind natürlich stets mit Vorsicht zu genießen. Aber das Beispiel der Ukraine zeigt, dass die Umfragen zumindest einen Trend widerspiegeln: den Trend unter jungen Männern, nicht in den Krieg zu ziehen. Unter dem Strich ist nämlich seit Beginn des Ukraine-Krieges für jeden Ukrainer, der kämpft, einer ins Ausland geflohen. Nun müssten Nato-Generalsekretär Rutte und Admiral Rob Bauer uns erklären, weshalb im Falle eines Eingreifens der Nato in der Ukraine junge Engländer, Deutsche und Amerikaner motivierter sein sollten, ihr Leben zu opfern, als die beträchtliche Anzahl der ukrainischen Männer, die sich ins Auto setzten und nachts über die grüne Grenze in den Westen fuhren.
Für viele dieser jungen Ukrainer sah es so aus: Die Russen greifen an, vielleicht werden sie Kiew erobern. Aber ist das ein Grund zu sterben? Könnte man nicht auch in Paris oder London ein interessantes Leben führen? Oder in Schanghai? Man müsste, um einen Tod auf dem Schlachtfeld für die heutigen jungen Männer plausibel zu machen, den Begriff des Vaterlandes revitalisieren und dessen Unantastbarkeit zur obersten Maxime erheben. Doch vielen ukrainischen Männern scheint der Begriff nicht mehr einzuleuchten – und jetzt erzähle man einmal einem deutschen Studenten aus Berlin, er müsse fürs Vaterland in einen Nato-Krieg ziehen! Viel Glück damit, Herr Rutte! Gescheiter wäre es, stattdessen von der Verteidigung von Freiheit und Demokratie zu sprechen, was ja auch gemacht wird.
Aber Freiheit und Demokratie gibt es auch in Australien oder Thailand, sogar auf Bali. Von den 25 Prozent mehrheitlich jungen Deutschen, die im Kriegsfall fliehen würden, können sich eben sehr viele vorstellen, Freiheit und Demokratie in einem Liegestuhl am Strand von Seseh auf Bali zu genießen und ihre Arbeit im Home-Office, mit dem Notebook auf den Knien, zu verrichten. Oder in Kanada, Toronto, tolle Stadt! Oder Sydney, auch dort gibt es Internet und Jobs. Sicher, das Leben im Ausland ist auch beschwerlich und kompliziert. Aber ist es nicht zehnmal besser, als von einer Granate zerrissen zu werden?
Der Gedanke fürs Vaterland zu sterben, überzeugt westliche junge Männer nicht
Der Gedanke, für den Schutz seines Vaterlandes zu sterben, ist in einer globalisierten, internationalisierten Zeit für westliche junge Männer einfach nicht mehr überzeugend. Zweifellos wird es solche geben, die kämpfen werden, nur schon, weil Mobilmachungen unter Kriegsrecht stattfinden, und nicht jeder kann sich einer Zwangsrekrutierung durch Flucht ins Ausland entziehen. Doch dass Anzahl und Moral der tatsächlich kämpfenden jungen Männer aus den Nato-Staaten ausreichen werden, um einen längeren Krieg zu führen, geschweige denn ihn zu gewinnen, ist unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, dass ein großer, konventioneller Krieg letztlich aufgrund von Personalmangel gar nicht mehr geführt werden kann.
Ist das nicht eine gute Nachricht? Sollte man nicht froh sein, dass es demografisch gesehen nur noch relativ wenige junge Männer gibt, von denen viele nicht mehr bereit sind, auf Kommando aus dem Nato-Hauptquartier für Interessen zu sterben, die sie nicht als die ihren empfinden? Möglicherweise ist es nur vorübergehend eine gute Nachricht, so lange, bis die Automatisierung des Krieges weitere Fortschritte macht. Der Trend geht zum autonom agierenden Kampfroboter, zu Lande und als Drohne in der Luft. Alle Großmächte arbeiten daran, die knappgewordene Ressource „wehrtüchtiger Mann“ durch KI-gesteuerte Industrieprodukte zu ersetzen, intelligente, selbstfahrende Panzer, ferngesteuerte Maschinengewehre auf Hydraulikbeinen und Roboter wie „Cheetah“ der amerikanischen Firma Boston Dynamics, der Munitionskisten schleppt, ohne zu murren! Die Kampfmoral dieser künstlichen Soldaten wird hervorragend sein!
Wenn wir Glück haben, dauert es noch zwanzig, dreißig Jahre, bis die Generäle diese supereffizienten und strapazierfähigen Kampfmaschinen in die Hände kriegen. Seien wir also optimistisch und bescheiden: Mehr als eine nur vorübergehend gute Nachricht kann man, was Krieg betrifft, realistischerweise nicht verlangen.
Der Text erschien zuerst in der Schweizer Weltwoche.