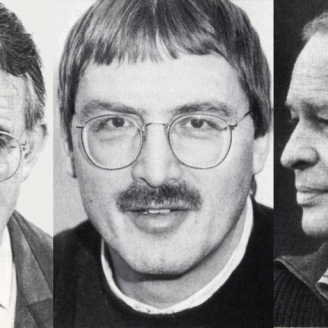Mucksmäuschenstill ist es im Stuhlkreis, als Lehrerin Annegret Zvonar eine Geschichte erzählt. Eine Freundin von ihr hat sie selbst erlebt. Sie geht so: Die Freundin geht mit ihrer sechsjährigen Tochter und ihren Eltern in ein Restaurant. Der Kellner stürmt auf die Familie zu, umarmt das Mädchen sehr fest, küsst es auf den Kopf und ruft: „Eine Prinzessin!“ Er lässt das Kind nur sehr zögerlich los und während des Essens berührt er es immer wieder, wenn er an den Tisch kommt. Das Mädchen sagt nichts, rutscht aber immer näher an seine Mutter heran. Auf dem Nachhauseweg bricht es aus ihr heraus: „Da geh ich nie wieder hin!“
„Was hättet ihr gemacht, wenn ihr das Mädchen gewesen wärt?“ fragt Lehrerin Zvonar ihre Fünftklässler. Die 28 Jungen sind nach den Sommerferien neu ans Bonner Collegium Josephinum gekommen, eine Jungenschule in kirchlicher Trägerschaft, Annegret Zvonar ist ihre Klassenlehrerin. „Ich hätte gesagt, dass ich das nicht will“, antwortet Elias. „Ich hätte versucht, mich loszureißen“, sagt Paul. „Ich hätte den weggeschubst, wenn ich genug Kraft gehabt hätte“, erklärt Leon.
Keine Frage: Die Jungen, alle zehn oder elf Jahre jung, haben genau verstanden, was da passiert ist: ein Übergriff.
Die Lehrerin fragt weiter: „Und warum haben die Erwachsenen nichts gemacht?“ Nachdenkliche Mienen im Stuhlkreis. „Vielleicht, weil der Kellner zwei Meter groß war?“ schlägt Alex vor. „Oder das war der Chef, und dann hätte der die ganze Familie rauswerfen können.“ Und schon ist die Schülerrunde auf kindgerechte Weise mitten in einer Diskussion über ein sehr heikles Thema: sexuelle Gewalt und Macht.
Zwei Stunden lang geht es heute Vormittag in diesem Klassenraum nicht um Mathe oder Englisch, sondern darum, wie man Nein sagt, wenn ein Erwachsener deine Grenze verletzt. Vor allem aber lernen die Neuankömmlinge, dass sie nicht allein sind, wenn es trotzdem passiert.
Am Ende dieser ungewöhnlichen Doppelstunde verteilen Klassenlehrerin Annegret Zvonar und Schulsozialarbeiter Holger Wondratschek eine Broschüre in den Schulfarben blau und orange. „Institutionelles Schutzkonzept“ steht darauf. „Das ist ein kompliziertes Wort“, sagt Wondratschek, und erklärt es den Kindern so: „Was können wir tun, damit diese Schule ein Ort ist, an dem ihr euch wohlfühlt, an dem ihr sicher seid, und an den ihr nicht mit Bauchschmerzen kommt? Darüber haben sich viele Leute Gedanken gemacht. Und hier drinnen stehen jetzt die Spielregeln dafür.“
Diese „Spielregeln“ sollen auch die Eltern kennen. Deshalb verteilt der Schulsozialarbeiter jetzt eine Empfangsbestätigung, die jedes Kind am nächsten Tag unterschrieben wieder mitbringen soll. Auf 43 Seiten regelt das Schutzkonzept, was LehrerInnen dürfen und was nicht, und da geht es durchaus auch schon um „kleine“ Grenzverletzungen. SchülerInnen mit Kosenamen ansprechen ist zum Beispiel verboten, Flirten mit SchülerInnen sowieso. Bei Klassenfahrten sind in Schlaf- oder Sanitärräumen „1 : 1-Situationen zwischen Begleitpersonen und SchülerInnen untersagt“. Für den Fall, dass es zu einem Übergriff kommt, sind AnsprechpartnerInnen für die Opfer aufgelistet, und zwar solche innerhalb und außerhalb der Schule. Und es gibt einen Einsatzplan, wie dann zwingend zu verfahren ist.
Aber es geht keineswegs ausschließlich um sexuellen Missbrauch in der Schule, zum Beispiel durch einen Lehrer, den Hausmeister oder auch durch einen anderen Schüler. Sondern auch darum, was die Schule tun kann, um zu erkennen, wenn ein Schüler oder eine Schülerin vom Stiefvater, vom Fußballtrainer oder Geigenlehrer missbraucht wird. „Die Schule ist für betroffene Kinder und Jugendliche ein wichtiger Ort, an dem sie sich anvertrauen und an dem sie Hilfe erhalten können“, steht dort.
Und so stellt sich Schulsozialarbeiter Wondratschek jetzt in den Stuhlkreis und hält ein Plakat hoch. „Wer hilft?“ steht darauf. 17 Köpfe sind zu sehen, Schulleiter Thomas Braunsfeld ist dabei, die vier BeratungslehrerInnen, Schulseelsorger Jürgen Langer und natürlich der Schulsozialarbeiter selbst. Das Plakat hängt auf allen Schulfluren und in jedem Klassenraum. Auch Annegret Zvonar wird es gleich in ihrer neuen Klasse aufhängen.
„Jetzt kommt was ganz Wichtiges“, sagt Zvonar und die nach zwei Stunden etwas wibbeligen Jungen werden schlagartig wieder still. „Wenn ihr etwas erlebt, von dem ihr merkt, dass es nicht in Ordnung ist, werdet ihr hier bei uns Menschen finden, die sich mit eurem Problem gut auskennen“, sagt die Klassenlehrerin. „Und es ist egal, ob dieses Problem in der Schule ist oder außerhalb“, fügt Holger Wondratschek hinzu. „Dieses Plakat ist unser Versprechen an euch, dass wir uns kümmern, wenn bei euch etwas schlecht läuft!“
Und auch für diesen Fall schreibt das Konzept mit dem komplizierten Namen einen klaren Handlungsablauf vor. Dazu gehört: 1. Den Betroffenen zuhören, ermutigen, sich mitzuteilen. 2. Die Inhalte des Gesprächs schriftlich protokollieren. 3. Die Präventionsfachkraft informieren. 4. Die Beratung einer externen geschulten Fachkraft in Anspruch nehmen. 5. Klären, ob sich der Verdacht erhärtet und welche Vorgehensweise nötig ist. 6. Vom ersten Hinweis an eine durchgängige Unterstützung durch eine Vertrauensperson sicherstellen.
Damit alle PädagogInnen wissen, wie sie mögliche Anzeichen für sexuellen Missbrauch erkennen können, und was sie dann zu tun haben, werden sie am Collegium Josephinum alle fünf Jahre fortgebildet, erfahren etwas über Opferverhalten und Täterstrategien. „Wir möchten an unserer Schule eine Kultur des Hinguckens“, sagt Schulleiter Thomas Braunsfeld.
Genau das schwebte Johannes-Wilhelm Rörig vor, als er im September 2016 die Kampagne „Schule gegen sexuelle Gewalt“ startete. „Schule ist der Ort, an dem wir alle Kinder erreichen können“, erklärt der „Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs“, der beim Bundesfamilienministerium angesiedelt ist. „Rein statistisch sind ein bis zwei Kinder in jeder Schulklasse von sexueller Gewalt betroffen.“ Weil LehrerInnen diese Kinder jede Woche viele Stunden lang erleben, sind vor allem sie diejenigen, denen etwas auffallen könnte und die sich Fragen stellen sollten. Warum ist das bisher lebhafte Kind neuerdings so still? Oder aggressiv? Weshalb sacken die Noten in den Keller? Und die dann wissen müssen, was genau zu tun ist.
Deshalb hat der Missbrauchsbeauftragte die Schulen im Rahmen der Kampagne mit einem Präventions-Paket ausgestattet und ein Schutzkonzept entwickelt, das er in allen 16 Bundesländern vorgestellt hat. Doch in vielen Schulen verstaubt das Konzept in der Schublade.
Zu diesem frustrierenden Ergebnis kommt das Deutsche Jugendinstitut (DJI), das gerade im Auftrag des Missbrauchsbeauftragten 5.000 Schulen zum Stand der Dinge befragt hat. Resultat: Zwar gibt es inzwischen an zwei von drei Schulen einzelne Maßnahmen, um SchülerInnen vor sexuellem Missbrauch zu schützen. Aber damit das wirklich funktioniert, braucht es mehr: vom Verhaltenskodex über feste AnsprechpartnerInnen im Verdachtsfall bis zum Handlungsplan. Alle müssen mit im Boot sein: LehrerInnen müssen fortgebildet, Eltern informiert werden. Die Schule sollte mit einer Beratungsstelle kooperieren. Im Unterricht muss Zeit für das Thema freigeschaufelt werden. Doch diesen Idealfall, fand das DJI heraus, gibt es nur an jeder siebten Schule. Und diese Zahl stagniert nun seit Jahren.
Maria Brinkmann glaubt zu wissen, was ein Grund dafür ist. „Die Schulen stehen unter unglaublichem Stress“, sagt die Schulleiterin der Göttinger Schule am Tannenberg. Immer mehr verhaltensauffällige Kinder in den Klassen, dazu kommen die Inklusionskinder und die Flüchtlingskinder, traumatisiert und ohne Deutschkenntnisse. „Und wenn sich eine Lehrerin dann allein um 28 Kinder kümmern muss, bleibt kaum noch Kraft und Zeit für ein so heikles Thema wie sexuellen Missbrauch.“
Die Schule am Tannenberg hat es besser: An der Förderschule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung sitzen nur sieben Kinder in einer Klasse, und die werden von drei Menschen betreut: einer LehrerIn, einer ErzieherIn und einer FSJlerin. Es war aber nicht nur dieser optimale Personalschlüssel, der Schulleiterin Maria Brinkmann schon im Jahr 2016 bewog, sich des heiklen Themas anzunehmen. Die Sonderpädagogin weiß: „Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung werden leichter Opfer als andere und gleichzeitig können sie sich schwerer äußern.“ Und tatsächlich hatten LehrerInnen und TherapeutInnen immer wieder einen Verdacht. „Woher kommen die blauen Flecken an der Innenseite der Oberschenkel? Warum lässt sie sich nicht mehr beim Duschen helfen? Aber wir wussten nicht genau, was wir dann machen sollten.“
Als dann die Göttinger „Beratungsstelle für sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen“ die Schule fragte, ob „wir bei einem Modellprojekt mitmachen wollen, kam uns das sehr entgegen“. Anderthalb Jahre lang wurden 16 PädagogInnen an insgesamt 15 Tagen darin geschult, Missbrauchs-Situationen zu erkennen. Ihre Erkenntnisse gaben sie anschließend an den Rest des Kollegiums weiter, auch an TherapeutInnen und Erzieherinnen der Tagesbetreuung. Sie schrieben Anleitungen für Gespräche mit Kindern inklusive konkreten Formulierungsvorschlägen, damit LehrerInnen behutsam herausfinden können, warum das Kind sich merkwürdig verhält. Sie verfassten ein Schreiben an alle MitarbeiterInnen der Schule. Titel: „Das komische Gefühl“. Wenn es auftaucht, das „komische Gefühl“, ist es „im Sinne eines Anfangsverdachtes in jedem Fall ernst zu nehmen“, steht dort. „Das gilt sowohl bei entsprechenden Vermutungen außerhalb (Familie, Schule, Verein) als auch innerhalb der Einrichtung.“
Und auch die SchülerInnen an der Schule am Tannenberg werden – nach einem Elternabend – ab der fünften Klasse „ermutigt, sich Hilfe zu holen“, erzählt Schulleiterin Brinkmann. An sechs ganzen Schultagen geht es um Gefühle und Geheimnisse, Körper und Berührungen, und natürlich ums Neinsagen. Das „supertolle Material“ mit einfachen Bildern und kurzen Sätzen sei „speziell für Kinder mit geistiger Behinderung entwickelt und gut verständlich“. Und tatsächlich haben sich „uns schon mehrere Kinder anvertraut.“
Initiiert wurde das Modellprojekt mit dem Titel „Beraten und Stärken“ von der „Deutschen Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmissbrauch, Vernachlässigung und sexualisierter Gewalt e. V.“, kurz: DGfPI, finanziert wurde es vom Bundesfamilienministerium.
Geld ist natürlich ein entscheidender Faktor, wenn man solche Projekte starten will. „Bund, Länder und Kommunen müssen sich noch viel konsequenter für den Kampf gegen sexuelle Gewalt und ihre Folgen einsetzen, auch durch die Bereitstellung zusätzlicher personeller und finanzieller Ressourcen“, mahnt der Bundesmissbrauchsbeauftragte Rörig. Er findet wie immer klare Worte: „Der aktuelle Zustandsbericht sollte Politik und Gesellschaft aufschrecken lassen.“
Aber nicht nur zu viel Stress und zu wenig Geld lassen die Schulen davor zurückschrecken, das Thema Missbrauch anzugehen. So manche Schule fürchtet auch, Eltern hielten ihre Kinder dann für besonders gefährdet. Dabei sei genau das Gegenteil der Fall, findet Schulleiterin Maria Brinkmann. „Wenn ein potenzieller Täter weiß: Das Kind geht auf eine Schule, an der alle hingucken, dann schützt das die Kinder!“
Auch das Bonner Collegium Josephinum hat sich entschlossen, nach vorne zu gehen, obwohl oder gerade weil es einen dunklen Fleck in seiner Vergangenheit hat. Noch bis Ende der 1960er-Jahre sind Schüler im Internat durch Patres missbraucht worden. Als im Jahr 2010 der katholischen Kirche der Missbrauchs-Skandal um die Ohren flog und auch die früheren Opfer am Collegium Josephinum begannen zu sprechen, mussten sich Redemptoristenorden und Schule entscheiden: Wegducken oder aufarbeiten? Sie entschieden sich für Letzteres.
„Mit unserem Präventionskonzept wollen wir die Gewalt der Vergangenheit nicht verdrängen, sondern ihre Wiederholung in jeder Form verhindern“, erklärt das Collegium Josephinum heute gleich auf der Startseite seiner Website.
Im Jahr 2016 verpflichtete dann das Kölner Erzbistum alle Schulen in katholischer Trägerschaft, ein Schutzkonzept zu entwickeln. Staatliche Schulen haben diese Verpflichtung nicht. Ein Fehler, findet der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. „Der Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt hängt in Deutschland noch viel zu oft vom Engagement Einzelner ab“, kritisiert Johannes-Wilhelm Rörig. „Wenn wir wollen, dass Kinder und Jugendliche in allen Einrichtungen maximalen Schutz und maximale Hilfe erhalten, brauchen wir dafür eine gesetzliche Verbindlichkeit.“
Gäbe es die, müsste Schulsozialarbeiter Holger Wondratschek jetzt nicht berichten, was er kürzlich von zwei Müttern hörte. Sie waren mit dem Schutzkonzept des Collegium Josephinum bei den Grundschulen ihrer jüngeren Kinder vorstellig geworden und hatten angeregt, es auch dort einzuführen. Reaktion: „Missbrauch? Sowas haben wir hier nicht!“ Der Sozialarbeiter ist über diesen Satz fassungslos. „Wir wissen doch inzwischen durch den Missbrauchsbeauftragten, dass in jeder Schulklasse ein bis zwei betroffene Kinder sitzen. Da müssten doch alle Schulen ihre Hausaufgaben machen!“