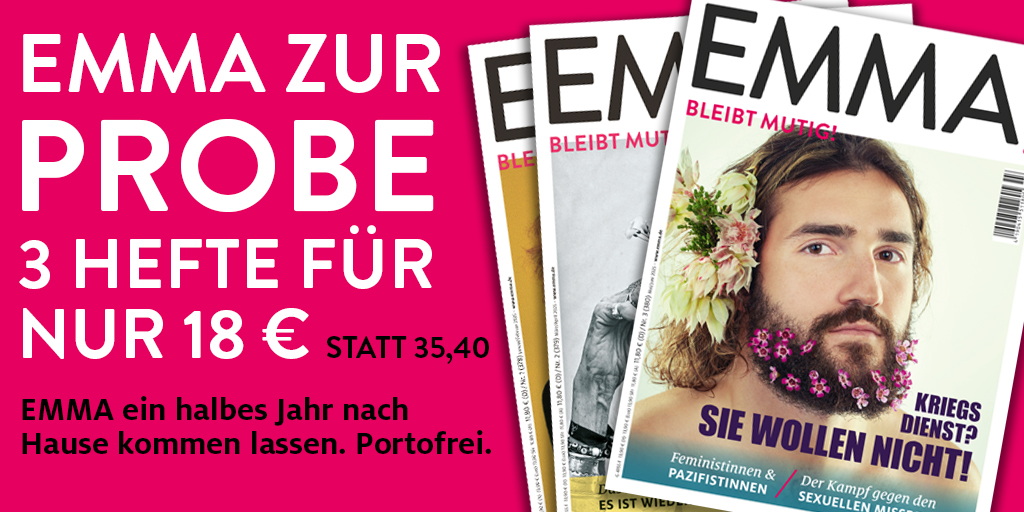Pazifistinnen: Sie wagten es!
Berlin, August 1914. Während in den Straßen die Soldaten unter dem frenetischen Jubel der Menschenmassen im Gleichschritt an die Front ausrücken, herrscht in der Spandauer Wohnung der Familie Kollwitz ein erbitterter Streit. Grund: Sohn Peter will in den Krieg. Erfasst von der patriotischen Euphorie, die im Kaiserreich tobt, will auch er sich freiwillig melden, wie so viele seiner Freunde. Der Junge ist erst 18, also nicht volljährig. Er fleht seine Eltern an, ihm die Erlaubnis zu geben. „Das Vaterland braucht meinen Jahrgang noch nicht, aber mich braucht es!“ brüllt er. Vater Karl, ein Armenarzt, ist entsetzt. Mutter Käthe ist – dafür.
Käthe Kollwitz ist schon damals eine bekannte Künstlerin. Und sie ist nicht gerade kaisertreu. Im Gegenteil: Es ist bekannt, dass sie den Sozialdemokraten nahesteht. In ihren Bilderzyklen über Bauernkriege und Weberaufstand hat sie immer wieder Armut und Elend der einfachen Bevölkerung angeprangert. Wilhelm II. verspottet ihre zerschlissenen Arbeiter und hungernden Kinder als „Rinnsteinkunst“.
Doch in diesen Wochen hat die allgegenwärtige Kriegspropaganda sogar die Frau ergriffen, die wir heute mit ihrem berühmten „Nie wieder Krieg“-Plakat als die große künstlerische Mahnerin gegen den Krieg kennen. Aber als Deutschland am 1. August 1914 Russland und zwei Tage später Frankreich den Krieg erklärt, ist sogar Kollwitz berührt, wenn die Propagandisten vom Krieg als „reinigendes Stahlbad“ schwärmen. Wenn es heißt, dass der „Einkreisung“ Deutschlands durch den „Erbfeind“ Frankreich im Westen und die „slawische Flut“ im Osten jetzt endgültig der Garaus gemacht werden müsse.
„Ich muss etwas zu meiner veränderten Einstellung zum Krieg sagen“, schreibt Kollwitz in ihr Tagebuch. „Zum ersten Mal empfand ich die absolute Gemeinsamkeit des Volkes. Ich empfand ein Neu-Werden in mir. Als ob nichts der alten Wertschätzungen noch standhielte, alles neu geprüft werden müsse.“ Sie überredet ihren Mann Karl, die Einverständniserklärung für den gemeinsamen Sohn zu unterschreiben.
Am 10. Oktober 1914 – Peter ist seit wenigen Tagen, gemeinsam mit fünf Millionen deutschen Männern, an der Front – nehmen die deutschen Truppen Antwerpen ein. Auf dem Weg zum Erbfeind Frankreich marschiert Deutschland völkerrechtswidrig durch das neutrale Belgien, das unerwartet Widerstand leistet. Der Durchmarsch, der in neun Tagen erledigt sein soll, dauert nun schon zweieinhalb Monate, und die Zivilbevölkerung bekommt die Wut der deutschen Besatzer durch Plünderungen und Massaker zu spüren.
Als Antwerpen fällt, notiert Käthe Kollwitz in Feierlaune: „Zum ersten Mal in unserem Leben hängen wir Sozialdemokraten, die wir bewusst sind und bleiben, die schwarz-weiß-rote Fahne des Kaisers aus der Stube. Das gilt unserem Peter und Antwerpen.“
Zwei Wochen später ist unser Peter tot, gefallen in Flandern. Und seine Mutter ist tief erschüttert: „Tod fürs Vaterland, das spricht sich so hin. Welch furchtbare Tragödie, welch Triumph der Hölle verbirgt sich hinter der glatten Maske dieser Worte.“
Es mag verwunderlich scheinen, dass es erst dieses persönlichen Dramas bedarf, um bei der Sozialistin Kollwitz die patriotische Blase platzen zu lassen. Aber es ist typisch. Die deutsche Kriegspropaganda ist gewaltig, und sie ist allgegenwärtig. „Deutschland, Deutschland über alles!“ titeln die Zeitungen und schwören das Volk auf den Kampf gegen den Feind ein. „Wie ein Mann erhebt sich das ganze deutsche Volk vom wehrpflichtigen Jüngling bis zum Landsturmmann zum Schutze der Heimat. Drohend stehen die Slawen an den heimischen Grenzpfählen in Hass gegen uns“, schreibt zum Beispiel die Lübecker Zeitung am Tag nach der deutschen Kriegserklärung und hofft: „Gebe Gott, dass wenn wir zum Schlage ausholen, der Sieg unser ist!“
Der Slawenhass ist, genau wie der Antisemitismus, gesellschaftsfähig. Ruft doch der Kaiser selbst zum „Rassenkampf“ der Germanen. Denn die „dunklen Völker“ im (Süd)Osten seien „nicht zum Herrschen geboren, sondern zum Dienen. Das muss ihnen beigebracht werden.“ Aber es sind keineswegs nur die traditionell Kaisertreuen, die zum Angriff für Volk und Vaterland blasen. Auch die deutsche Avantgarde der Dichter und Denker steht stramm in Reih und Glied.
In seiner Antrittsvorlesung referiert zum Beispiel der Soziologe und Sozialist Max Weber über die „tiefstehenden physischen und geistigen Lebensgewohnheiten“ des polnischen Bauern und plädiert dringlich für eine „Hemmung der slawischen Flut“. Und Thomas Mann jubelt: „Deutschlands ganze Tugend und Schönheit – wir sehen es erst jetzt – entfaltet sich erst im Kriege.“ Kollege Hermann Hesse sekundiert: „Die moralischen Werte des Krieges schätze ich im Ganzen sehr hoch ein.“
So sieht das auch der Maler Franz Marc: Was die Revolution von 1789 für Frankreich gewesen sei, werde dieser Krieg jetzt für den ganzen Kontinent sein, nämlich ein „heilsamer, wenn auch grausamer Durchgang“ zu einem neuen Europa. Marc meldet sich freiwillig.
Bald darauf weicht der Heroismus dem Entsetzen. Der Maler klagt: „Der Leichengeruch auf viele Kilometer im Umkreis ist das Entsetzlichste.“ Sein Freund und Kollege August Macke schreibt an seine Frau: „Diese Nacht haben wir ein schauderhaftes Nachtgefecht in einem Dorf gehabt, viele Tote und Verwundete.“ Beide werden im Krieg ihr Leben lassen.
Aber noch herrscht allgemeine Kriegsbegeisterung. 69 Intellektuelle, darunter Theaterdirektor Max Reinhard oder Physikprofessor Max Planck, verwahren sich in einem Appell „An die Kulturwelt“ gegen den Vorwurf, Deutschland führe einen Angriffskrieg. Dabei lag der „Schlieffenplan“, der einen Zwei-Fronten-Krieg gegen Frankreich und Russland vorsieht, seit Jahren in der kaiserlichen Schublade. Und nach dem Attentat von Sarajewo, bei dem (vermutlich) serbische Attentäter den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand ermordeten, hat Deutschland seinem Verbündeten Österreich-Ungarn eine Blankovollmacht ausgestellt: Was auch immer die Habsburger Monarchie unternehmen wolle – Deutschland wäre unverbrüchlich an Österreichs Seite. Vier Wochen später erklärt Österreich-Ungarn Serbien den Krieg.
Auch unter den politischen Parteien gibt es keine mehr, die für den Frieden plädiert. Im Gegenteil: Selbst die SPD, die sich anfangs noch als Pazifisten-Partei profiliert hatte, ist nun auf Kriegskurs eingeschwenkt. In den Wochen nach dem Sarajewo-Attentat hatte die Parteipresse über die grölenden Jubelzüge junger Bürgersöhne zu den Kriegerdenkmälern noch geschrieben: „Sie drücken nicht den Willen des Volkes aus. Das Volk will Frieden.“
Nach der deutschen Kriegserklärung am 1. August 1914 tönt es anders bei den Genossen: Nun müssen „deutsche Kulturgüter und deutsche Fluren“, vor allem aber deutsche Frauen und Kinder gegen die „halbasiatischen, schnapsgefüllten russischen Kosakenhorden“ verteidigt werden, hetzt Redakteur Otto Braun im sozialistischen Vorwärts. Am 4. August winkt die SPD im Reichstag die Kriegskredite durch. Und der Kaiser erklärt von seinem Schlossbalkon aus: „Ich kenne keine Parteien und Konfessionen mehr, wir sind heute alle deutsche Brüder!“
Nur eine deutsche Frauenrechtlerin hat den Mut, gegenzuhalten. Sie hält sich nicht an das Gebot der Stunde, das da lautet: „Die Waffen hoch! Das Schwert ist Mannes eigen / Wo Männer fechten, hat das Weib zu schweigen!“ Lida Gustava Heymann schweigt nicht. Sie schreit laut auf vor Entsetzen. „Diese Worte, welch einen Abgrund von Unkultur, Grausamkeit, Verrohung, Völkerhass, wirtschaftlicher Not, namenloses Herzeleid und Elend enthalten sie“. So klagt sie am 15. September 1914 auf der Titelseite der Zeitschrift Die Frauenbewegung.
Heymann gehört, wie die Herausgeberin der Frauenbewegung, Minna Cauer, zum radikalen Flügel der Frauenbewegung. Das heißt: Sie ist strikt dagegen, Frauen (und Männern) im Namen ihrer „Natur“ bestimmte Rollen bzw. angeblich angeborene Eigenschaften zuzuschreiben. Folgerichtig kämpft sie für eine volle Gleichstellung der Frauen, gegen ihre Entrechtung in Ehe und Gesellschaft – und natürlich für das Frauen-Wahlrecht.
Die Hamburger Patriziertochter Heymann verfügt über ein stattliches Vermögen, das sie seit Jahren in Mädchenschulen oder Armenspeisungen investiert. An ihrer Seite ist Anita Augspurg, vormals eine schillernde Figur der Münchner Bohème, die in der Schweiz als erste deutsche Frau Jura studiert hat (wie auch Rosa Luxemburg), um gerechte Gesetze für ihre Geschlechtsgenossinnen zu erstreiten.
Das Arbeits- und Lebenspaar ist nicht nur kompromisslos feministisch, sondern auch pazifistisch. Und es benennt früh die Folgen des Krieges für Frauen. Als 1900 in China der Boxeraufstand gegen die Kolonialmächte tobt, prangern Augspurg und Heymann die Vergewaltigungen der chinesischen Frauen durch Soldaten an. Krieg ist für die Frauenrechtlerinnen „das größte Verbrechen“, der „Kulminationspunkt männlicher Raff- und Zerstörungswut“.
Und es ist sicher kein Zufall, dass der Erste Weltkrieg sich anbahnt, als die Erste Frauenbewegung Anfang des neuen Jahrhunderts auf dem Höhepunkt ihres Erfolges ist. Der Männlichkeitswahn, der das Herzstück eines jeden Krieges bildet, gibt den verunsicherten Helden ein Stück Selbstbewusstsein zurück, stellt ihr erschüttertes Rollenbild wieder auf knobelbecherfeste Füße.
Lida Gustava Heymann und Anita Augspurg erfahren von der Mobilmachung Deutschlands am 31. Juli 1914. Sie verbringen den Sommer auf ihrem einsam gelegenen Bauernhof in Irschenhausen im Isartal. Als sie an diesem Tag ins Rathaus gehen, um dort eine Grundstücksangelegenheit zu regeln, hören sie, dass die Katastrophe eingetreten ist: Es ist Krieg.
Auf der Rückfahrt zum Hof, so schreibt Heymann in ihren Memoiren, sind den beiden Frauen zwei Dinge klar: „Erstens: Hilfe konnte nur von Frauen kommen. Zweitens: Wir würden keine Arbeit für direkte Kriegszwecke leisten, wie Hospitaldienst, Verwundetenpflege. Halbtot geschundene Menschen wieder lebendig und gesund machen, um sie abermals den gleichen oder noch schlimmeren Qualen auszusetzen? Nein, für solchen Wahnsinn würden wir uns nicht hergeben.“
Heymann in ihren Memoiren: „Es waren nur wenige innerlich überzeugte Pazifisten in den ersten Augusttagen 1914, aber diese wenigen litten unmenschliche seelische Qualen. Abgeschnitten von der Welt, durch nichts verbunden mit der eigenen Nation, dem Hohn und Spott ihrer Umgebung preisgegeben, verlassen von Freunden, Bekannten und Verwandten, waren sie einsam, einzeln zerstreut, völlig machtlos, ohne jede Solidarität.“
Lida Gustava Heymann braucht sechs Wochen, dann wagt sie es. Auf die Solidarität ihrer Schwestern vom gemäßigten Flügel der Frauenbewegung kann die Pazifistin nicht zählen. Im Gegenteil. Gertrud Bäumer, die Vorsitzende des „Bundes Deutscher Frauenvereine“ (BDF), hat klare Vorstellungen davon, welchen Part die Frauenbewegung nun zu übernehmen hätte: „Wir Frauen fühlen uns mit aufgenommen in dieses große, ernste Zusammenwachsen aller nationalen Kräfte zu einem großen, gemeinsamen Willen: durch den uns aufgezwungenen Weltkrieg die Macht und Größe unserer Nation zu erhalten“, verkündet sie im Zentralblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine.
Bereits am 31. Juli hatte die Lehrerin ein Rundschreiben an alle dem BDF angeschlossenen Organisationen geschickt und erläutert, wie der BDF einen „Nationalen Frauendienst“ aufbauen will, der sozusagen an der Heimatfront seinen Mann bzw. seine Frau stehen wird. Also wird die Mehrheit der deutschen Frauenbewegung Teil der Kriegsmaschinerie.
Ebenfalls mit von der Partie sind die sozialdemokratischen Frauen – auch wenn die entschiedene Kriegsgegnerin Clara Zetkin versucht, es zu verhindern. Sie alle geloben, während der für das Vaterland so harten Kriegszeit ihre Kämpfe um die Frauenrechte einzustellen.
Das kleine Häuflein Pazifistinnen ist auf sich gestellt. Es sind fast ausschließlich die „Radikalen“, die sich verweigern: die Blattmacherin Minna Cauer, die Sexualreformerin Helene Stöcker, die Österreicherin Rosa Mayreder – und natürlich die brillante Schriftstellerin Hedwig Dohm.
„Wie soll ich den schaurigen Wahnsinn des Gedankens fassen, dass Millionen schuldloser Geschöpfe sich gegenseitig abwürgen, die einander nie etwas zuleide getan?“, fragt sie 1915 verzweifelt in einem Text, dessen Veröffentlichung auch die Avantgarde-Zeitschrift Aktion mitten im Hurra-Geschrei für unpassend hält. Er wird erst 1917 veröffentlicht werden, als schon Millionen Soldaten in Bombenhagel und Giftgas elend krepiert sind.
Die Pazifistinnen stellen dem nationalistischen Wahn die internationale Solidarität entgegen. In der Frauenbewegung schreibt Heymann im September 1914: „Wir trauern mit den Frauen aller Nationen, die ihr Liebstes hergeben mussten, oder denen ihr Liebstes verstümmelt an Leib und Seele heimkehrt. Wir reichen den Frauen aller Nationen, die mit uns gleichen Sinnes sind, die Hand.“
Das tun Heymann und ihre Mitstreiterinnen nicht nur auf dem Papier, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. Sie rufen auf zu einem großen Frauen-Friedenskongress. Lida Gustava Heymann entwirft einen flammenden Aufruf: „Frauen Europas, wann erschallt euer Ruf? Wo bleibt Eure Stimme? Seid Ihr nur groß im Dulden und im Leiden? Versucht zum mindesten, dem Rad der Zeit, menschlich, mutig und stark, würdig eures Geschlechtes in die bluttriefenden Speichen zu greifen!“
Solche „antipatriotischen“ Töne lässt sich die Obrigkeit nicht bieten. Die Polizei durchsucht Heymanns Münchner Wohnung, aber das Flugblatt ist schon verschickt und verteilt. Das bayerische Kriegsministerium beschlagnahmt es, wo immer es auftaucht. In Berlin wird Minna Cauer, die es abgedruckt hat, zur Zensurbehörde des Heeres-Oberkommandos einbestellt.
Aber die Pazifistinnen, die durch ihren Kampf um das Frauenstimmrecht über beste Beziehungen zu den Frauenrechtlerinnen anderer Länder verfügen, schaffen es trotzdem: Am 28. April 1915 kommen in Den Haag über 1.000 Frauen aus 13 europäischen Ländern von Schweden bis Ungarn zusammen, sowie aus den USA und Kanada. Die meisten Teilnehmerinnen sind Holländerinnen. Die 180 Pazifistinnen aus England und Irland fehlen, denn Premierminister Churchill hat kurzerhand verfügt, dass zum Kongressbeginn der Schiffsverkehr über den Ärmelkanal eingestellt wird. Auch den Französinnen wird die Ausreise verweigert. Deutschland ist mit 28 Teilnehmerinnen vertreten und schickt damit, nach den Vereinigten Staaten, die größte Delegation.
Der „Bund Deutscher Frauenvereine“ ist nicht dabei. Gertrud Bäumer hatte mitgeteilt, dass „der Besuch des Kongresses den nationalen Verpflichtungen der deutschen Frauen entschieden widersprechen würde. Es wird als eine unbedingte Pflicht und Solidarität innerhalb der deutschen Frauenbewegung bezeichnet, dass ihre Mitglieder dem Kongress fernbleiben.“ Der scharfe Ton lässt vermuten, dass es im BDF durchaus Sympathisantinnen gab, denen eine Teilnahme in deutlichen Worten untersagt werden musste.
Während die Pazifistinnen in Den Haag gemeinsam über Wege zum Frieden debattieren, kämpft in Karlsruhe eine Frau einen einsamen – und letzten – Kampf gegen den Krieg: Clara Immerwahr. Die erste promovierte Chemikerin Deutschlands ist die Ehefrau von Fritz Haber, dem Leiter des Kaiser-Wilhelm-Instituts für physikalische Chemie und späteren Nobelpreisträger. Gemeinsam hat das Ehepaar an der Herstellung von Ammoniak geforscht, um, so Claras Traum, mit dem daraus herstellbaren Kunstdünger den Hunger in der Welt zu bekämpfen.
Doch Fritz Haber hat andere Pläne, denn er hat noch etwas entdeckt: das Chlorgas. Kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs übernimmt der Forscher beim deutschen Generalstab die Leitung der Einsätze chemischer Massenvernichtungswaffen. Am 2. Mai 1915 will Haber wieder an die Westfront aufbrechen, um den nächsten Einsatz seines Giftgases zu überwachen.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Deutschland bei der Schlacht von Ypern am 22. April 1915 zum ersten Mal Giftgas als Kriegswaffe eingesetzt, Zehntausende krepierten elend. Clara Immerwahr fleht ihren Mann an, nicht zu fahren und das Unternehmen abzubrechen. Sie kann es nicht fassen, dass er sich in den Dienst des Massenmords stellt. Für sie ist das von ihm entwickelte Giftgas „eine Perversion der Wissenschaft und ein Zeichen der Barbarei“. Haber aber findet, dass „ein Wissenschaftler in Friedenszeiten der Welt gehört, im Krieg aber seinem Land“. Am Ende des Krieges werden Fritz Habers Chlorgas 100.000 Menschen zum Opfer gefallen sein.
Ehefrau Clara hat nicht die Macht, ihn zu hindern. Die brillante Wissenschaftlerin, die gegen alle Widerstände studiert, promoviert und sogar Patente angemeldet hatte, wurde von ihrem Mann und Co-Forscher nach der Eheschließung immer weiter ins Haus und in die Bedeutungslosigkeit abgedrängt. „Was von mir übrig ist, erfüllt mich selbst mit der tiefsten Unzufriedenheit“, schreibt sie 1909 an ihren Doktorvater. Nur „ein bisschen Lebensrecht“ sei ihr geblieben. Fritz Haber bricht auf an die Front – gegen den Willen seiner Frau. Am selben Abend erschießt sich Clara Immerwahr.
Zur gleichen Zeit tragen die Pazifistinnen ihre Botschaft in die Welt. In Den Haag haben sie ihre Forderungen in einem Abschlussdokument mit 20 Punkten zusammengefasst, das man auch und gerade aus heutiger Sicht nur als bahnbrechend bezeichnen kann. Sie protestieren gegen die Kriegsvergewaltigungen. Sie fordern die Einbeziehung der Frauen in alle politischen Prozesse. Sie fordern sofortige Friedensverhandlungen und einen Frieden ohne Gebietsübertragungen. Zur Vermeidung künftiger Konflikte soll ein internationaler Schiedsgerichtshof eingerichtet werden, der Konflikte zwischen Nationen schlichtet. Sie klagen ein Ende der Geheimdiplomatie ein und wollen den internationalen Waffenhandel unter Aufsicht stellen. Die Herstellung von Waffen und Munition soll verstaatlicht werden, damit Kapitalinteressen ausgeschaltet werden. In den Schulen sollen die Kinder zum Friedensgedanken erzogen werden.
Schließlich wählen die Pazifistinnen, die in Den Haag die „Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit“ gründen, eine Gruppe Frauen aus neutralen Ländern, die alle kriegführenden Regierungen aufsuchen sollte, um ihnen ihre Beschlüsse zu erläutern.
Und tatsächlich: In ganz Europa werden die Frauenrechtlerinnen empfangen. In Norwegen von Regierung und König, in Rom vom Papst. In Wien vom Außenminister, in Berlin immerhin vom Staatssekretär des Auswärtigen Amtes. Den Krieg beenden die Pazifistinnen damit nicht. Aber als 1917 der amerikanische Präsident Woodrow Wilson seinen Friedensplan verkündet, ist der Den Haager 20-Punkte-Katalog die Basis des Plans des Präsidenten.
Es ist nicht das erste Mal, dass Frauen aus aller Welt im gemeinsamen Kampf für den Frieden Geschichte schreiben. Schon ein Vierteljahrhundert zuvor war es eine Frau gewesen, die mit einem Paukenschlag den Wahnsinn des Krieges international entlarvt hatte: Bertha von Suttner.
1889 hatte die österreichische Generalstochter mit ihrem Anti-Kriegs-Roman „Die Waffen nieder!“ die Welt aufgerüttelt. Der Roman schildert die Gräuel des Kriegs aus Sicht einer Ehefrau. Der Schwede Alfred Nobel, den Suttner später zur Schaffung des Friedensnobelpreises anregen wird, schreibt der Österreicherin: „Ich habe die Lektüre Ihres bewundernswerten Meisterwerks vollendet. Man sagt, es gäbe zweitausend Sprachen – aber sicherlich gibt es nicht eine, in die Ihr herrliches Werk nicht übersetzt, in der es nicht gelesen und besprochen werden sollte.“ Tatsächlich wird „Die Waffen nieder!“ in 27 Sprachen übersetzt, wird also ein Weltbestseller.
1892 gründet die Feministin und Pazifistin von Suttner zunächst die Österreichische und dann die Deutsche Friedensgesellschaft. Am 15. Mai 1899 ist es soweit: Die erste weltweite Frauendemonstration für den Frieden findet statt. Allein in den USA gehen 75.000 auf die Straße, in Deutschland kommen Friedensdemonstrantinnen in München, Dresden und Berlin zusammen. In der Hauptstadt endet die Demonstration mit einer Frauen-Versammlung in der Philharmonie. Hauptrednerin ist Bertha von Suttner.
1905 wird die unermüdliche Pazifistin mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Den Ausbruch des Ersten Weltkriegs wird sie nicht mehr erleben. Sie stirbt am 21. Juni 1914, eine Woche vor dem Attentat von Sarajewo. Einen Monat, bevor die Katastrophe beginnt, an deren Ende Europa in Schutt und Asche liegt.
Im Deutschland weicht die patriotische Jubelstimmung langsam, aber sicher der Verzweiflung. Mit dem „Blitzkrieg“ ist es nichts geworden, das Elend zieht sich über Jahre. Die Frauen, die zu Hause nicht wissen, wie sie die hungrigen Mäuler stopfen sollen, versammeln sich zu wütenden „Hungerprotesten“. Und die Pazifistinnen um Heymann und Augspurg lassen nicht nach, obwohl der Druck immer größer wird und Heymann 1917 wegen „unpatriotischer Umtriebe“ sogar aus Bayern ausgewiesen wird.
In einem „Geheimen Schreiben zur Werbetätigkeit deutscher Pazifisten, insbesondere der Frauen“ beklagt das Berliner Kriegsministerium: „Insbesondere unter den deutschen Frauen wurde eine lebhafte Propaganda entfaltet. Die Agitation zur Herbeiführung eines Friedens um jeden Preis blieb in den letzten Monaten indes nicht mehr auf schriftlichen Gedankenaustausch und geschlossene Versammlungen von Phantasten und vaterlandslosen Personen beschränkt. Auch auf der Straße in großen, an Aufruhr grenzenden Massenversammlungen, an denen hauptsächlich Frauen beteiligt waren, erklang bereits in mehreren Städten der Ruf nach Brot und Frieden.“ All diese Vorkommnisse, heißt es weiter, müssten „ernsthafte Besorgnisse erregen“.
Im Herbst 1918 ist es soweit. Jetzt wollen auch die Soldaten nicht mehr. In Kiel beginnen die Matrosenaufstände, in Berlin ist Generalstreik, in München wird die Räterepublik ausgerufen. Am 9. November dankt Kaiser Wilhelm ab und flieht nach Holland. Der Krieg ist aus. Der Krieg, in dem 15 Millionen Menschen getötet und weitere 20 Millionen verletzt und verstümmelt wurden. Die Traumatisierten und vergewaltigten Frauen nicht mitgezählt.
Am 19. Januar 1918 beginnen in Paris die Friedensverhandlungen. Den Kriegsverlierern, darunter Deutschland, werden große Lasten aufgebürdet. Und wieder einmal mischen sich die Pazifistinnen ein. Wieder einmal lassen sie sich, auch nach vier schrecklichen Kriegsjahren, nicht vor den nationalistischen Karren spannen. In Zürich kommt die „Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit“ zusammen, die sich 1915 in Den Haag gegründet hatte. Die Liga fasst Beschlüsse, die eine fünfköpfige Delegation – bestehend aus einer Amerikanerin, einer Britin, einer Französin, einer Italienerin und einer Schweizerin – den verhandelnden Herren in Paris überreicht.
Dort ist wieder einmal Gerechtes zu lesen: „Der Internationale Frauenkongress spricht sein tiefes Bedauern darüber aus, dass die in Versailles vorgeschlagenen Friedensbedingungen die Grundsätze so schwer verletzen, die allein einen gerechten und dauernden Frieden sichern können. Dadurch, dass die Friedensbedingungen die Früchte der Geheimverträge den Siegern sichern, wird das Recht des Siegers auf Kriegsbeute anerkannt und über ganz Europa eine Missstimmung und Feindseligkeit verbreitet, die nur zu weiteren Kriegen führen können.“
Im Januar 1923 fordern Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann, die inzwischen in München leben, mit einer Frauendelegation vom Bayerischen Innenminister Franz Schweyer die Ausweisung eines gewissen Adolf Hitler nach Österreich, nach einem besonders brutalen Überfall seiner Nazis auf eine Versammlung, bei der eine Teilnehmerin schwer verletzt wird.
Man hat nicht auf die Frauen gehört. Wieder einmal nicht. Lida Gustava Heymann und Anita Augspurg sterben 1943 in Zürich, im Schweizer Exil. Sie standen ganz oben auf der Schwarzen Liste des neuen Kriegstreibers: Adolf Hitler.
Der hier gekürzte Text erschien zum ersten Mal in EMMA 4/14 zum 100. Jahrestag des Kriegsbeginns.
Ausgabe bestellen