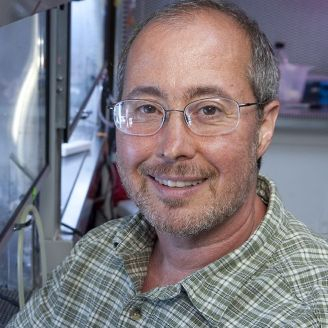Transsexuelle: Ohne Vergangenheit?
Von der angeblichen Feindschaft zwischen Transsexuellen und Feministinnen – oder „Transsexuelle exkludierenden radikalen Feministinnen“ (TERFs), einem abwertenden Begriff, der in den Nullerjahren von Fürsprecherinnen der Transsexuellen eingeführt wurde – hatte ich schon gehört und erfuhr später noch mehr darüber. Soweit ich es beurteilen konnte, passte dieses Etikett auf einige altgediente Separatistinnen, die Transsexuelle aus dem (heute nicht mehr existenten) Michigan Womyn‘s Music Festival verbannen wollten, oder auf Fans von Janice Raymonds Manifest aus dem Jahr 1978, „The Transsexual Empire: The Making of the She-Male“, das zwar einige durchaus scharfsinnige Gedanken formulierte, jedoch Mann-zu-Frau-Transsexuelle als chirurgisch modifizierte Monster darstellte, die potenziell in weibliche Räume eindringen, „Frauen aus der Mutterrolle verdrängen“ und metaphorisch Frauen „vergewaltigen“, indem sie sich ihren Körper aneignen.
Ich sah mich nicht in der Schablone der Klischee-Feministin, die eine Klischee-Transsexualität verunglimpft. Doch die wiederkehrenden Sticheleien gegen den Feminismus in den Lebenserinnerungen, die ich las, erleichterten mir die Unvoreingenommenheit nicht gerade. „Befreiung wovon?“, schrieb Nancy Hunt in „Mirror Image“ herablassend über die Frauenbewegung. „Von der Anmut, Freiheit, Schönheit und emotionalen Spontaneität des Frauseins?“ Dieses Urteil wurde mit den Jahren nur noch lauter.
„Dass die Weiblichkeit zum Sündenbock gemacht wird, ist mittlerweile die Achillesferse der feministischen Bewegung“, schrieb Julia Serano 2007 in ihrem populären Manifest „Whipping Girl: A Transsexual Woman on Sexism and the Scape-goating of Femininity“ (erschienen im feministischen Verlag Seal Press). Serano fand die „feministische Unterstellung, dass ‚Weiblichkeit etwas Künstliches‘ sei, narzisstisch, arrogant, offen frauenfeindlich und überheblich gegenüber denen, für die sich Weiblichkeit richtig anfühlt“. Den feministischen Antagonismus gegenüber traditioneller Weiblichkeit schrieb Serano dem „Umstand zu, dass viele Frauen, die sich besonders stark vom Feminismus angezogen fühlen, die traditionellen weiblichen Genderrollen als einengend oder unnatürlich empfinden. In vielen Fällen liegt das an ihrer eigenen Neigung, ihr Gender auf außergewöhnliche Art zum Ausdruck zu bringen“. Weniger höflich formuliert ist das die alte Behauptung männlicher Chauvinisten, Feministinnen seien Feministinnen, weil es ihnen an Femininität fehle.
Eine Klischee-Feministin, die eine Klischee-Transsexualität verunglimpft?
Je länger ich mich in jenem Jahr und auch später durch die Bücherstapel der Bibliothek arbeitete, desto mehr nervten mich diese Bücher mit ihrem vertraulichen „Wir-Mädels-unter-uns“-Ton, den Bildern naiver Highschool-Mädchen im rosa Twinset auf dem Cover, den Kapitelüberschriften in den runden geschwungenen Buchstaben antiquierter Werbeanzeigen für Damenbinden. Die in vielen dieser Aufzeichnungen vertretene Genderidentität war aggressiv mustergültig, kindlich, häufig prüde und merkwürdig entsexualisiert.
Der Mann, so berichteten die Autorinnen, stromerte einst durch exotische Unterwäscheabteilungen, geplagt von Scham und Schmerz ob seiner Geilheit, wohingegen das neue Mädchen eine unschuldige Jungfer von hohem Anstand war, dankbar, sich bei einem Mann unterzuhaken, verlegen, wenn ein „dreckiger Witz“ erzählt wurde, beschämt, wenn ihre Schuhe nicht zur Handtasche passten. Ich dachte an meinen Vater und die „extravaganten“ Puff-Fummel, die sie zugunsten „anständiger“ Damenkleidung in einen Wandschrank im Flur verbannt hatte, an die FictionMania-Sexfantasien, die sie ausgedruckt und dann im Regal versteckt hatte. War es wirklich so leicht, Ich und Über-Ich, Identität und Begehren zu trennen?
Die Betroffenen machten mir in ihren Autobiografien weis, dass sie die psycho-sexuellen und psychischen Verwirrungen des Erwachsenen überwunden hatten; aus dem Vamp war eine Jungfrau mit der präsexuellen Unschuld eines Kindes geworden.
In ihren Lebenserinnerungen „Wrapped in Blue: A Journey of Discovery“ aus dem Jahr 2006 (auf dem Cover: eine blasse Blondine von hinten, gehüllt in eine blaue Samtstola, in der Hand eine Rose) erzählt Donna Rose, wie begeistert sie die Geschenke entgegennahm, die ihr ihre Mutter zur Feier ihrer Geschlechtsumwandlung ins Krankenhaus brachte, „einen rosa Teddybär“ und „eine Packung rosa Kaugummizigaretten mit der Aufschrift ‚Es ist ein Mädchen!‘". Rose war zu diesem Zeitpunkt 41 Jahre alt.
Deirdre McCloskeys „Crossing“ aus dem Jahr 1999 fing vielversprechender an: „Wenn ich gegenüberstelle, wie Männer und Frauen ‚sind‘, will ich nicht die Stereotypen oder Essenzialismen erneuern, die gern zum Nachteil anderer Frauen angeführt werden. Frauen sind nicht immer liebevoll, und nicht immer geht ihnen jedes Interesse an ihrer beruflichen Laufbahn ab.“ Eine Transfrau mit Beruf, erklärte sie, „möchte ihn auch weiter ausüben und entschwebt nicht in einen Fifties-Himmel aus Plätzchenbacken und Kaffeeklatsch“.
Stereotypen über männliche Rüpelhaftigkeit und Frauen, die Hausarbeit lieben
Doch selbst McCloskey, Professorin für Wirtschaft und Geschichte, erging sich anschließend in Stereotypen über männliche Rüpelhaftigkeit und Frauen, die „an einem Glas Chablis nippen“, „leidenschaftlich gern im Haushalt werkeln“ und den heimeligen „Plausch unter Frauen“ mögen. Sie erstellte eine Liste ihrer neuen fraulichen Weitsicht: hasst Kriegsgeschichten, findet Sport langweilig, kann nur „weibliche Romanautoren“ lesen, kocht gern, macht jeden Morgen ihr Bett, „ist vernarrt in jedes Kind, das ihr begegnet“, und „liebt die kleinen Liebesdienste der Frauen über alles, verschickt Karten, bringt Charles, der ein paar Häuser weiter wohnt, einen Hackbraten vorbei“. Und sie geht für ihr Leben gern einkaufen. „Nur mit großer Mühe konnte sie einem wunderschönen Paar italienischer Slipper zum Preis von 100 Dollar widerstehen.“ (Sie erzählte ihre Geschichte in der dritten Person.) Ein volles Kapitel war dem Make-up gewidmet. „Eyeliner: L‘Oreal flüssig, das ausdrucksstärkste Schminkutensil. Sie zieht den Lidstrich im Stil der Fifties.“
Lag ich falsch, wenn mich das abschreckte?
Vergeblich suchte ich nach einem Bericht, in dem sich die transsexuelle Autorin fragte: „Könnte es sein, dass ich das Frausein auch deshalb anstrebe, weil ich meine Unschuld wiedererlangen, mich von den Sünden meiner männlichen Vergangenheit befreien will?“ Oder: „Sehne ich mich womöglich nach der moralischen Größe, die sich gerade aus Unterdrückung ergibt?“ Oder: „Will ich eine Frau sein, damit ich das Gefühl habe, etwas Besonderes zu sein? Umjubelt? Geliebt?“
Ließ sich die komplexe Geschichte eines Individuums, ließen sich die jeweils einzigartigen Kämpfe, Enttäuschungen, Sehnsüchte eines Lebens wirklich so sauber in eine Flasche mit dem Etikett „Identität“ abfüllen? Seit Freud widmet sich die Kunst der Psychotherapie der Aufgabe, die vielen an der Oberfläche scheinbar einheitlichen Aspekte des Charakters auseinanderzudröseln. Seit Erikson zielt die Suche nach Identität offenbar wieder auf das Gegenteil ab, auf die Leugnung psychischer Verwicklungen, auf die Suche nach dem großen Streich, der alles erklärt, der die gesamte Lebensgeschichte in eine Markenidentität verwandelt.
Gibt es keinen Seinszustand zwischen dem Hyperfemininen und dem Hypermaskulinen?
Aber was geschieht, wenn mittels „Identität“ „Psychologie“ ausgeblendet wird? Wie lässt sich verhindern, dass sich aus dieser Marke der „Totalismus“ entwickelt, vor dem Erikson warnte?
„Jedes dieser Abenteuer verläuft auf direktem Weg vom einen Pol sexueller Erfahrung zum anderen“, machte Sandy Stone 1991 in ihrem Aufsatz „The ‚Empire‘ Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto“ ihrem Herzen Luft. „Wenn es im Kontinuum der Sexualität ein Dazwischen gibt, so ist es jedenfalls unsichtbar. Kein Wunder, dass feministische Theoretikerinnen misstrauisch sind. Verflucht, ich bin misstrauisch.“
Stone, Medientheoretikerin und Mann-zu-Frau-Transsexuelle, hatte sich ähnlich bestürzt wie ich durch einige der frühen Autobiografien von Transsexuellen gearbeitet. „Diese Autorinnen reproduzieren das stereotype männliche Narrativ von der Konstitution der Frau: Kleidung, Makeup und hilflose Ohnmacht beim Anblick von Blut“, schrieb sie. Alle lieferten eine ähnliche „Beschreibung der ‚Frau‘ als männlichem Fetisch, als einer Person, die eine sozial erzwungene Rolle reproduziert“, und alle präsentierten sich als Heldin des Märchens „von der Froschkönigin“. Keine scheine willens zu sein, sich einen Seinszustand zwischen dem Hyperfemininen und dem Hypermaskulinen auch nur vorzustellen.
Stones Untersuchung bereitete weiteren TransgenderautorInnen den Weg, die die Beschränkungen dieser Literatur hinterfragen und sich selbst zu „Gender-Outlaws“ erklärten. Bei der Arbeit an ihrer Replik stellten sich Stone zahlreiche Fragen, die in den auch von mir gelesenen Lebenserinnerungen nicht vorkamen.
Die Anpassung des Körpers an eine sexistische Auffassung von Weiblichkeit & Männlichkeit?
Wie sollte das Verhältnis Transsexueller zu ihrem „früheren“ Ich aussehen, und was hatte es zu bedeuten, wenn jemand die eigene Vergangenheit tilgte? Wenn eine Person ihren Körper so veränderte, dass er „aussah“ wie das Geschlecht, dem sie sich zugehörig fühlte, passte sie sich dann den gängigen engstirnigen und sexistischen Auffassungen von Weiblichkeit und Männlichkeit an, oder konnte sie vielmehr mithilfe dieser Veränderungen aufzeigen, dass die Biologie kein Schicksal ist? Dass „Trans“ nicht nur für eine Überschreitung der Gendergrenze steht, sondern für ein Transzendieren des Genderbegriffs insgesamt?
Solange das „Überschreiten“ die Währung der Transsexualität war, so schloss Stone, beraubten sich Transsexuelle „der Möglichkeit, die Komplexität und Ambiguität gelebter Erfahrung authentisch zu repräsentieren“.
Stone rief die anderen Transfrauen dazu auf, sich ihre echten Lebensgeschichten zurückzuerobern und sie als Rammbock gegen die Betonmauern der Genderbinarität einzusetzen: „Transsexuelle müssen Verantwortung für ihre Geschichte übernehmen, ihr Leben neu formulieren, nicht als Abfolge von Löschungen ..., sondern als politische Aktion, die damit beginnt, dass sie sich die Verschiedenheit zu eigen machen und wieder Anspruch auf die Macht über den neu geformten und neu definierten Körper erheben.“ Sie sollten sich, so schlug Stone vor, weder als „Frauen“ noch als „Männer“ definieren, sondern als eine Mischung aus beidem, als Vertreterinnen unbestimmter und vielfältiger Gender, deren Existenz die Grundannahmen einer auf zwei Geschlechter beschränkten Welt bedroht.
Der Text ist ein Auszug aus "In the Darkroom" (Deutsch: "Die Perlenohrringe meines Vaters"), aus dem Englischen von Judith Elze und Anne Emmert, dtv Verlag.