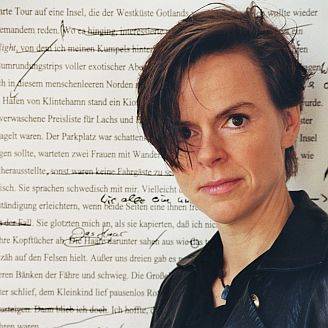Zusammen, was zusammengehört?
"Ich bin doch keine Emanze! Ich bin Werkzeugmacher, habe einen Mann, den ich meistens liebe, und außerdem trage ich gern einen BH. Euren Feminismus brauchen wir nicht, den leben wir bereits.“ Das waren Irmgard Waltzmanns Ansichten 1976.
Zwanzig Jahre später hört sich das schon anders an: „Ich bin Bankkauffrau, glücklich geschieden und man könnte sagen Vollblut-Emanze. Der BH ist aber geblieben. Heute sage ich, wir hätten euren Feminismus nach der Wende gut gebrauchen können und ihr unseren. Die Crux war nur, dass beide Seiten nicht verstanden haben, wie die Inhalte wirklich aussahen. Es hat einige Jahre gedauert, bis ich realisiert habe, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau noch lange nicht vollendet ist und dass über den Feminismus neu verhandelt werden sollte. Man muss nur bedenken: Die Emanzipation von Ostund West-Frauen, das sind zwei Kapitel für sich und 40 völlig konträre Jahre.“ Und diese Kapitel haben es in sich.
Ich bin doch keine Emanze! Ich bin Werk-
zeugmacher!
Denn mit dem Fall des Eisernen Vorhangs sind zwei (Frauen)Welten aufeinander geprallt, und mit ihnen ein Pulverfass aus Missverständnissen, Propaganda und Ignoranz. Auch zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung bedeutet ein Land und ein Geschlecht noch längst keine innere Einheit. Noch immer hält sich im Osten das Klischee der dekadenten West-Frau, die sich trotz Frauenbewegung mit dem Titel ihres Mannes anreden lässt, ihre Kinder als Lebenselixier betrachtet und am liebsten in Teilzeit oder gar nicht arbeitet. Genauso kursiert im Westen das Bild des grauen Mäuschens aus dem Osten, der Rabenmutter, die ihr Neugeborenes nicht schnell genug in die Krippe verfrachten kann, zur Arbeit geht und meint, damit wäre für die Gleichberechtigung doch alles getan.
So weit der Klassenkampf. Die Realität sah anders aus – auf beiden Seiten. „Die Frauenbewegung und der Feminismus der BRD sind in der DDR systematisch verunglimpft worden, die Informationen wurden gefiltert und Frauenrechtlerinnen als frustrierte, männerhassende Hausfrauen abgestempelt. Feminismus wurde als subversive Kraft gefürchtet. Die Bürgerinnen der DDR haben Seite an Seite mit ihren Männern gearbeitet, sie glaubten die Ziele der Frauenbewegung längst umgesetzt zu haben“, erklärt Uta Schlegel, Soziologin aus Leipzig und eine der wenigen Frauen, die bereits zu DDR-Zeiten über Frauen-Benachteiligung wg. Geschlecht geforscht haben. Wohlgemerkt in einer Zeit, in der das Wort Feminismus in der DDR nicht einmal in Wörterbüchern auftauchte.
„Gerade das Klischee von der ‚Männerfeindlichkeit‘ war eine strategisch gute Waffe“, erinnert sich Schlegel. „Ost-Frauen glaubten, völlige Gleichberechtigung nur mit den Männern erreichen zu können. Die feministische Perspektive fehlte, Selbstverwirklichung wurde unabhängig vom Geschlecht diskutiert und meist als Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft aufgefasst. Schon der Terminus Feminismus wurde propagandistisch mit dem Ziel in Verbindung gesetzt, weibliche Herrschaft errichten zu wollen und so zum Spaltungsfaktor degradiert.“
Eine Scheidung drängte Frauen nicht an den Rand der Gesellschaft
Und die antifeministische Propaganda hat gegriffen, fiel sie doch auf einen guten Nährboden, gerade in der ersten Hälfte der 70er Jahre. Die Hausfrauenehe war in der DDR historisch so gut wie ausgemustert. Durch den gelebten doppelten Lebensentwurf – Arbeit und Kinder – fühlten sich die Frauen gleichberechtigt und identifizierten sich mehrheitlich mit dem Staat, der ihnen ökonomische und reproduktive Autonomie ermöglichte. Es gab Jobs, die steuer- und familienrechtlich flankiert wurden, der Lebensunterhalt war preiswert, die Kinderversorgung durch ausreichend Krippenplätze sicher gestellt. Mutterschaft wurde weniger mystifiziert, eine Scheidung drängte keine Frau – auch nicht mit Kindern – an den Rand der Gesellschaft.
1972 führte die DDR die Fristenlösung ein, das Recht auf Abtreibung in den ersten drei Monaten. Was die West-Frauen sich (beinahe) erkämpft hatten, das wurde den Ost-Frauen „geschenkt“ – damit sie gar nicht erst auf dumme Gedanken kamen. „Viele Frauen haben dieses Gefühl der staatlichen Absicherung internalisiert und bis heute behalten. Sie haben ihre Rechte als Bürgerinnen sehr dezidiert wahrgenommen. Bis 1975 haben sich zwei Drittel aller DDR-BürgerInnen stark mit ihrem Staat identifiziert, erst ab 1986 gab es den Erdrutsch“, meint Frauenforscherin Schlegel.
Frauen schufteten genau wie Männer als Kranführerinnen, Schlosserinnen, auf dem Bau oder in der industriellen Landwirtschaft. Zupacken-Können war keine Geschlechterfrage, es war normal für alle. Ebenso normal war aber auch, dass die Hauptverantwortung für Kinder und Haushalt bei der Frau lag. Doppelter Lebensentwurf gleich doppelte Belastung.
Es war Pflicht, Beruf und Kinder unter einen Hut zu bringen
Vom Staat wurden die Frauen in erster Linie unter funktionalem Aspekt betrachtet: als Arbeitskräfte und als stabilisierender Faktor für Ehe und Familie. Frauenpolitik und -förderung waren Familienpolitik, schufen für Frauen nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Pflicht, Beruf und Mutterschaft unter einen Hut zu bringen. Schlegel: „Geschlechtsunterschiede wurden im Sozialismus teilweise sogar zementiert.
Es gab einen Haushaltstag pro Monat für jede Frau, sie erhielt, der Erkenntnis geschuldet, dass es anscheinend sehr wohl Vereinbarungsprobleme gab, eine gesetzliche 35-Stunden-Woche bei Vollerwerbsarbeit, wenn sie zwei schulpflichtige Kinder hatte, oder zunächst ein Babyjahr“.
Und die Frauenforscherin fährt fort: „Natürlich haben Ost-Männer im Haushalt ‚geholfen‘, vielleicht etwas mehr als im Westen, aber Hausarbeit blieb Frauenarbeit. Nebenbei bemerkt haben Männer auch bei der Hausarbeit die prestigeträchtigeren Aufgaben übernommen: wie Autowaschen, Gartenarbeiten oder Tapezieren. Die niederen Hausarbeiten und die Gesamtverantwortung lagen bei der Frau. In dieser Hinsicht schenkten sich West und Ost rein gar nichts.“
Hinzu kam, dass Frauen, die keine Mütter sein wollten oder gar homosexuell waren, vom Staat benachteiligt wurden, sie bekamen Probleme im Job oder bei der Wohnungssuche. Die DDR regierte paternalistisch von oben nach unten, Politik für Frauen wurde nie von Frauen selbst gemacht. Kaum eine schaffte es ins Politbüro oder in Ministerämter. Im Westen wie Osten waren es die Männer, die beruflich protegiert wurden, als Akademiker bessere Forschungsthemen, mehr Lohn erhielten. In der DDR gab es zwar den Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“. Nur zufällig wurden überall dort, wo vorwiegend Frauen arbeiteten, die geringeren Löhne gezahlt. DDR-Arbeiterinnen verdienten rund 25 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, die gab es auch.
Sexuelle Belästigung wurde nicht als Problem wahrgenommen
„Gerade auf dem Land warst du als Frau manchmal Freiwild, wurdest bei der Arbeit begrabscht und musstest dir dumme Sprüche anhören. Das alles wurde nur nicht als gesellschaftliches Problem wahrgenommen, sondern als individuelles. Man las darüber auch nichts in den Zeitungen. Da war der Westen weiter“, erinnert sich Christa Diepholdt aus Leipzig, die zu DDR-Zeiten in der LPG Dröschkau arbeitete. „Allerdings passierte so etwas wie Vergewaltigung in der Ehe nicht so oft, einfach weil Frauen staatlich finanziell abgesichert waren und solche Beziehungen schnell und einfach beenden konnten. Die Scheidungsneigung war generell höher als im Westen.“
Das Nachdenken über die Unterdrückung der Frauen hatte eben nicht den Stellenwert wie die Reflexion über das Leben im Sozialismus. Diese Umstände erklären, warum Frauen sich, anders als die Frauen im Westen, nicht strukturell benachteiligt fühlten, sondern etwaige Ungerechtigkeiten auf individuelle Unzulänglichkeit zurückführten. Auch war an Aufklärer-Werke wie Simone de Beauvoirs „Das andere Geschlecht“ oder Alice Schwarzers „Der kleine Unterschied“ schwer heran zu kommen. Frauenforscherin Schlegel erinnert sich: „Ich selbst, als Wissenschaftlerin, die zu dem Thema promovierte, konnte allerdings den Giftschrank der Deutschen Bücherei in Leipzig benutzen und war gerade von diesen beiden Büchern schwer beeindruckt.“ Dabei war sie damals 18 Jahre lang Abteilungsleiterin am Zentralinstitut für Jugendforschung in Leipzig.
Immerhin fand das Bewusstsein über die Benachteiligung von Frauen einen Weg in die Literatur ostdeutscher Autorinnen und so endlich eine Gegenöffentlichkeit, da Literatur in der DDR nahezu als einziges Medium Konfliktstoff verarbeiten durfte. Wenn es so etwas wie einen DDR-Feminismus gab, dann in der Literatur. Hier wurde die staatlich verordnete Gleichberechtigung auf Alltagstauglichkeit überprüft, der Stand der Emanzipation aufrichtig diskutiert. Die Texte von Irmtraud Morgner, Christa Wolf, Brigitte Reimann, Sarah Kirsch oder Maxie Wander übten erstmals Systemkritik aus Frauenperspektive für Frauen.
Der Feminismus hatte ein tiefes Imageproblem in der DDR
Ganz wie ihre Leserinnen waren die Autorinnen der Meinung, dass der Emanzipationsprozess bei allem, was die Gleichberechtigung durch Arbeit mit sich brachte, stockte, über ein gewisses Maß nicht hinaus kam. Dass viele der Autorinnen dennoch Angst hatten, in die feministische Ecke abgestellt zu werden, verweist auf das tiefe Imageproblem des Feminismus in der DDR. Auch wurden Veröffentlichungen unter der Rubrik Frauenbücher schnell in die Nähe von Trivial literatur gerückt, fanden in der offiziellen Literaturdebatte nicht statt. Gegen Ende der 80er brodelte es im Arbeiter- und Bauernstaat, besonders unter seinen Bürgerinnen. Nach dem Mauerfall saßen sich schließlich zwei Fraktionen gegenüber: erfahrener BRD-Feminismus hier, gelebte DDR-BürgerInnenrechte dort.
Ostlerinnen sind mit „deutlich flacher hierarchisierten Geschlechterverhältnissen“ – so Schlegel – und einer ganz anderen Erlebniswelt in die Wiedervereinigung gegangen. Westlerinnen waren ganz anders sensibilisiert für die Benachteiligung wg. Geschlecht. Und auch die Inhalte differierten. „Sexuelle Übergriffe und Missbrauch waren in der DDR nicht so ein Thema“, erzählt Schlegel. „Die DDR-Gesellschaft war weniger pornografisiert und weibliche Diskriminierung nicht so evident. Die Weiblichkeitsmuster sahen anders aus, und die finanzielle Unabhängigkeit, sowie ihr hoher Bildungsstand hatten Frauen selbstbewusst gemacht.“
"Wir waren alle überfordert, haben uns zu sehr von Angst leiten lassen"
Ostlerinnen sahen sich nach 1989 plötzlich Medien ausgeliefert, die titelten: „Endlich braucht die Ostfrau nicht mehr zu arbeiten!“ und Schönheits-, Jugend- und Schlankheitswahn propagierten. Das Wertesystem wurde neu geordnet. Die Erwartungen der BRD-Frauenbewegung, die auf Power-Frauen aus dem Osten gehofft hat, waren zu hoch. Eine Solidarisierung fand nicht statt, Probleme wurden nach dem alten Muster individuell gelöst. Nicht der Staat ist schuld, sondern ich bin schuld.
Schlegel resümiert: „Die Ost-Frauen haben viel verloren, aber nichts, was sie selbst erkämpft hatten. Große Ausnahme: das viel diskutierte und für das Geschlechterverhältnis progressive neue Familiengesetz von 1965. Ansonsten bekamen sie das, was sie als Gleichberechtigung erlebt haben, vom Staat auf dem Silbertablett präsentiert. Während die Frauen der BRD aktiv basisdemokratisch agierten, zum Beispiel mit Frauenhäusern und Frauenprojekten, waren die Frauen der DDR an Gleichberechtigungsprozessen wie dem Schaffen des Schwangerschaftsabbruchgesetzes gar nicht beteiligt. Das muss man wissen.“
„Wir hätten früher mehr kämpfen müssen“, meint Irmgard Waltzmann heute. „Gerade in Bezug auf den § 218. Die gesetzliche Angleichung an den West-Paragrafen war für Ost-Frauen damals ein totaler Rückschritt. In der Übergangsphase gab es übrigens einen regelrechten Abtreibungstourismus. Hunderte West-Frauen haben nun nicht mehr in Holland, sondern im Osten abgetrieben. Ich glaube, letzten Endes waren wir alle überfordert und haben uns auf beiden Seiten von Propaganda, Missverständnissen und sehr viel Angst leiten lassen. Ich finde, es ist immer noch höchste Zeit, gemeinsam stärker an einem Strang zu ziehen.“