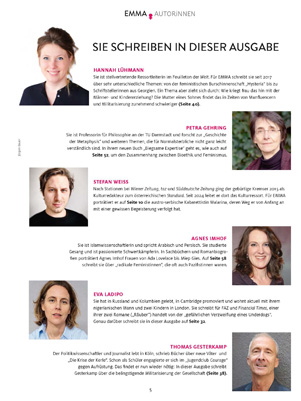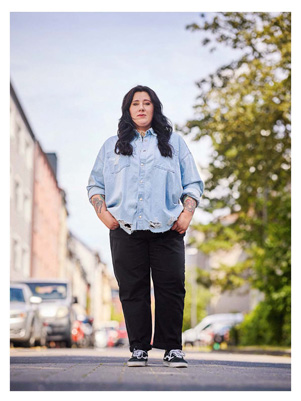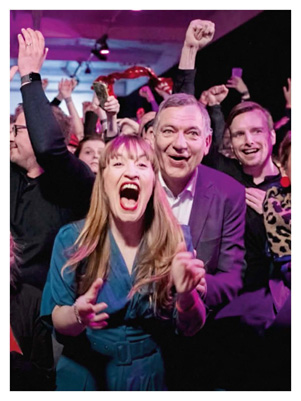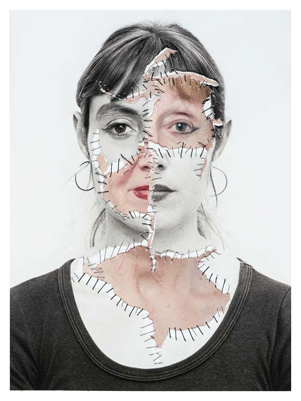Kochenden Frauen: Wir sind gut!
In dem Moment, in dem Frauen begannen, die Rolle als Hausfrau infrage zu stellen, wurde die weibliche Küche zu einem Politikum. Die Entwicklungsgeschichte der weiblichen Kochkunst vollzog sich im Spannungsfeld zweier rigoroser Rollenzuweisungen: „Eine Frau gehört an den Herd“, lautete die eine. Die andere behauptete das Gegenteil: „In der Spitzengastronomie haben Frauen am Herd nichts zu suchen.“ Die Verbindlichkeit dieser beiden orthodox anmutenden Zuweisungen hat sich in den vergangenen 150 Jahren abgeschwächt. Heute finden wir immer mehr Frauen in der Sternegastronomie und immer weniger Frauen am häuslichen Herd. Beide Entwicklungen bedingen einander.
Drei historische Phasen haben an dieser Verschiebung mitgewirkt: Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Jahrhundertwende, die so genannte Belle Époque, in der die bürgerliche Küche mehr und mehr zu einer Angelegenheit von Prestige und Repräsentation wurde, in deren Folge nicht nur die Gründung von Restaurants, Grandhotels und Kochschulen einen Boom erlebte, sondern auch Kochbuchautorinnen für die bürgerliche Küche an Einfluss gewannen. Dann die 1930er-Jahre, in denen die ersten Köchinnen mit Sternen im „Guide Michelin“ ausgezeichnet wurden. Und nicht zuletzt: die Emanzipationsbewegung der 1970er-Jahre. Sie war auch für die Entwicklung der weiblichen Kulinarik ein nicht zu unterschätzender Motor und trug wesentlich dazu bei, dass die weibliche Kochkunst von einer reinen Hausfrauen-Angelegenheit allmählich zur Frauensache werden konnte.
Bevor die weibliche Emanzipation ihre ersten Blüten trieb, genoss die Küche der Frauen in der öffentlichen Meinung kaum Prestige. Denn sowohl die bäuerlich geprägte vorindustrielle als auch die vormoderne bürgerliche Gesellschaft gründeten auf der Prämisse, dass die Aufgabenverteilung zwischen Mann und Frau strikt geschlechtsspezifisch zu erfolgen habe. Demnach hatte die Frau im Hause und der Mann in der Öffentlichkeit zu wirken. Die häuslichen Pflichten der Frau wurden als natürliche Begabungen angesehen, welche die Weiblichkeit gleichsam als Säugling mit der Muttermilch verinnerliche.
Kochen für die Familie galt als Hausarbeit, und wenn eine Frau sich darin eine gewisse Übung erworben hatte, war das ausschließlich durch Erfahrung angeeignetes Wissen und keinerlei methodischer Unterrichtung geschuldet. Man ging davon aus, dass sich das weibliche Schalten und Walten naturhaft entfalte und nicht durch eine Ausbildung aufgewertet zu werden bräuchte. Und weil Hausarbeit nicht bezahlt wurde, war sie in den Augen der Berufsköche eine unqualifizierte Tätigkeit, die nicht den Anspruch erheben durfte, eine Kunst zu sein.
Aus dem Einheitsbrei der Untertanen entwickelten die Frauen über Jahrhunderte die Cuisine Feminine.
Die häusliche Küche der Frauen blieb für den größten Teil der Bevölkerung noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts in der Tradition der Armeleuteküche verwurzelt. Der Beruf des Kochs hatte sich im Zeitalter des Feudalismus an den Fürstenhöfen herausgebildet, in einer Epoche, in der die Bevölkerung Europas nahezu überall die gleichen Dinge aß, weil es kaum etwas anderes gab: Getreidebrei und Mus, Hülsenfrüchte, Kohl und Rüben, gestöckelte Milch, Käse und Eier. Schmalz und Öl statt Butter, Bier und Most statt Wein. Erst im 18. Jahrhundert bürgerte sich die Kartoffel ein.
Der Einheitsbrei der Untertanen-Bevölkerung erschwerte die Entwicklung einer abwechslungsreichen, raffiniert den Gaumen kitzelnden Küche, mit der sich hätte Eindruck schinden lassen. Es zählt zu den großen Kulturleistungen der hauswirtschaftlichen „Cuisine Feminine“, auf der Grundlage dieser kärglichen Mittel, die überdies in Zeiten ständiger Missernten und Hungersnöte nie mit Sicherheit zur Verfügung standen, etwas hervorzubringen, was heute Teil unserer kulturellen Identität ist: eine europäische Regionalküche mit einer Fülle lokaler Spezialitäten. Alleine aus Eiern und Mehl und, je nachdem, etwas Milch oder Schmalz, lässt sich der Teig für Piroggen und Pies, Pasteten und Pasta bereiten, lassen sich Puddings und Pfannkuchen rühren, Nudeln und Nockerln formen.
Nur die Aristokratie und das städtische Patriziat verfügten anfangs über die Mittel, die es ihnen erlaubten, sich all die verlockenden Dinge in die Küche zu holen, mittels derer sich gewöhnliche Alltagsrezepte in die Sphäre der Kochkunst emporheben ließen: Gewürze und Spezereien, Zucker und Liköre, Hochwild und edles Federvieh, Butter, Rahm und Exotisches wie Kaffee, Tee und Kakao.
Bereits in der Hochkultur der alten Ägypter wurde die Position des Hofkochs prinzipiell mit einem Mann besetzt. Über 5000 Jahre lang hatten männliche Köche das Monopol der höfischen Kochkunst und somit der repräsentativen Küche inne. Das hing unter anderem damit zusammen, dass sich die Institution des Hofes aus dem Militärdienst heraus entwickelt hatte. Unseren Großmüttern war das Wissen um diese historische Tradition noch gegenwärtig. Die Kochbuchautorin Mary Hahn schrieb 1920: „Der Koch ist ein Feldherr, und wie oft im Kriege geht es bei ihm verschwenderisch zu.“
Der ursprüngliche Sinn und Zweck des Dienstes bei Hofe bestand darin, den König und dessen Familie zu schützen, und so schloss die Funktion des Hofkochs auch die Pflicht mit ein, die Soldaten des Landesfürsten zu verpflegen. Viele Erfindungen der Nahrungsmittelindustrie wie beispielsweise die Margarine oder das Büchsenfleisch gehen auf das Drängen von Feldherren wie Napoleon zurück, die händeringend auf der Suche nach haltbaren, leicht zu transportierenden Nahrungsmitteln für ihre Armeen waren und deren technische Entwicklung forcierten.
Angesichts dieses militärischen Erbes erscheint es nicht verwunderlich, dass der Umgangston in den Küchen bei Hofe alles andere als zimperlich war. Der Kulturhistoriker Leo Moulin weiß von einer Ordre zu berichten, die sich an den Koch am Hofe des Grafen von Burgund im 16. Jahrhundert richtete: „Er muss befehlen und für Ordnung sorgen, und es muss ihm gehorcht werden.“ Daran hat sich bis heute in den Küchen der Sterne-Gastronomie nicht wirklich etwas geändert; nach wie vor kommuniziert man dort in der Manier von Feldwebeln.
"Die Köchinnen mögen sich tunlichst aus unseren Arbeiten heraushalten, die für sie zu anstrengend sind." Koch Gilbert 1983
Noch im Jahr 2004 wusste die amerikanische Autorin Kathleen Flinn, die sich an der Pariser Kochschule „Le Cordon Bleu“ einschrieben hatte, zu erzählen, sie und ihre Mitschüler seien dort zu guten „Fußsoldaten ausgebildet worden, die gelernt hätten, Befehle entgegenzunehmen“.
Das hat eine lange Tradition. Im Laufe des 18. Jahrhunderts begannen die Frauen nichtsdestotrotz, die Männerbastion der hohen Schule der feinen Küche mehr und mehr für sich zu erobern. Das 19. Jahrhundert, das große Zeitalter der bürgerlichen Kultur, bot ihnen schließlich die ideale Bühne, ihre Kunstfertigkeiten einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Wachsender Wohlstand und das ausgeprägte Renommierbedürfnis der aufstrebenden bürgerlichen Schichten ließen einen neuen Lebensstil erblühen, in welchem die häusliche Tischkultur eine glänzende Rolle besetzte. Was dem Kaiser sein Mundkoch war, war dem Bürger jetzt seine Köchin. Die Kochkunst der Küchenperle unterlag dem gleichen Zweck wie die Kunst eines Hofkochs: Sie diente dazu, das Ansehen eines Hauses zu mehren.
War es für die männlichen Köche schon schwer genug, sich in dem Konkurrenzkampf der Zunfthandwerke Respekt zu verschaffen, so setzten sie alles daran, wenigstens die Frauen auf Abstand zu halten. Berühmt sind die Bemühungen der Schneiderzünfte, Schneiderinnen als Pfuscherinnen zu verunglimpfen und ihnen den Zugang zur Zunft abzuschneiden. Das Ringen der Köche um ein Gewerbemonopol, um eine geregelte Ausbildung (vom Lehrling über den Gesellen zum Meister) und um die Zulassung zur Arbeitsgerichtsbarkeit war ein rein männliches Unterfangen, auch deshalb, weil es als unhinterfragt gottgegeben empfunden wurde, dass die Frau als Magd doch eigentlich am heimischen Herd ganz gut aufgehoben sei. Wozu sollte sie da eigener Rechte bedürfen?
Köche in privaten Diensten benahmen sich wie Snobs. Sie gaben sich die größte Mühe, sich über ihre kochenden Kolleginnen zu erheben: „Daher mag sich auch die Mehrheit der Köchinnen tunlichst aus unseren Arbeiten heraushalten, die für ihren Frauenkörper zu anstrengend sind und die sie – ich möchte fast sagen – schlecht zu imitieren im Stande sind“, urteilte der französische Koch Philéas Gilbert 1883 in der Zeitschrift L’ art culinaire.
Goutiert haben mochten die Köche vermutlich auch das Geschmacksurteil des „Baierischen National-Kochbuchs“ von 1824, in dem es eben hieß, in einer von Frauen geführten Küche sehe es aus „wie in einem Waschhaus“ – es fanden sich zu jener Zeit eine Handvoll Lexikonschreiber und Gastrosophen, die dieses Menetekel in ihren gelehrten Abhandlungen fortschrieben.
Die Eroberung der Sternegastronomie durch die Frauen vollzog sich in etwa zeitgleich mit der Durchsetzung des allgemeinen, gleichen und freien Frauenwahlrechts. Den Pariserinnen gestand man das Wahlrecht 1871 zu, den Finninnen 1906, den US-Amerikanerinnen aller Bundesstaaten 1920, den Engländerinnen 1928; die deutschen Bürgerinnen erhielten es 1918, die Französinnen landesweit hingegen erst nach dem Zweiten Weltkrieg, 1946.
Dafür kann die Grande Nation sich rühmen, im Jahr 1933 zum ersten Mal in der Geschichte auch Köchinnen mit drei Sternen im „Guide Michelin“ ausgezeichnet zu haben. Bei den solchermaßen geehrten Damen handelte es sich um Marie Bourgeois, genannt La Mère Bourgeois, und ihr Restaurant im Örtchen Priay, etwa 50 Kilometer von Lyon entfernt, sowie um Eugénie Brazier, genannt La Mère Brazier. Die Ehrung für Madame Brazier war eine entschieden extraordinäre, denn diese außergewöhnliche Köchin führte zu jener Zeit zwei Restaurants, eines in der Rue Royale in Lyon und eines namens Col de la Luère in einem Dorf, 17 Kilometer westlich von Lyon. Für beide Restaurants erhielt Eugénie Brazier zur gleichen Zeit jeweils drei Sterne, also insgesamt sechs auf einen Streich.
Eugénie Brazier (1895 bis 1977) war das, was man im Französischen „un personnage“ nennt: eine starke Persönlichkeit. Schon rein äußerlich war sie eine bemerkenswerte Erscheinung. Mit ihrem Dutt, ihrer korpulenten Statur, die durch eine gebundene Schürze Form und Kontur erhielt, sowie mit ihren zupackenden Händen und mächtigen Armen flößte sie bereits auf den ersten Blick Respekt ein. Auch charakterlich war sie ein rechtes Weibsbild: impulsiv und großherzig, streitbar und tatkräftig, eigenwillig und stur.
Sie entstammte einer kleinbäuerlichen Familie aus der Bresse und ging im Alter von 19 Jahren als Mädchen für alles bei der kinderreichen Familie des Lyoner Teigwarenfabrikanten Joseph Milliat in Stellung. Im Haushalt der Milliats erwies sich, dass ihr das Kochen leicht von der Hand ging. Bis dahin hatte sie nie eine Kochschule von innen gesehen; sie hatte die elementaren Handgriffe lediglich als Mädchen von der Mutter abgeguckt. Doch Eugénie Brazier hat die Perfektionierung ihres Kochtalents durchaus zielstrebig vorangetrieben.
1915 quittierte sie den Dienst bei den Milliats und ging in Lyon im Restaurant von Françoise Fayolle, genannt Mère Filloux, bis zum Ende des Ersten Weltkriegs in die Lehre. 1921 machte sie sich selbstständig. In der Rue Royale Nummer 12 eröffnete sie eines jener typischen Lyoner Arbeiterbistros. Doch unter den Fittichen von Mère Brazier taten sich bourgeoise Feinschmecker ebenso gütlich wie Leute, die hart arbeiten mussten. Als „plat du jour“ servierte Mère Brazier Köstlichkeiten wie geschmortes Bressehuhn mit Trüffeln oder Steinbutt, den sie in einer ganzen Flasche Chambertin badete, einem Burgunderwein feinster Lage.
Bei Madame Brazier gaben sich nicht nur Seidenweber und Rhôneschiffer, sondern auch Prominente die Klinke in die Hand; Marlene Dietrich war da, der Bürgermeister von Lyon war Stammgast, General de Gaulle kehrte bei ihr ein, und eines Tages tauchte sogar ein indischer Maharadscha auf, der sie, nachdem er ihren bretonischen Hummer genossen hatte, vom Fleck weg als Leibköchin engagieren wollte.
Doch Mère Brazier blieb standhaft. Sie triezte lieber weiterhin ihre Schüler wie beispielsweise den jungen Paul Bocuse, der bei ihr 1946 als Lehrling anfing. Er schuftete, wie seine Chefin auch, jeden Tag von morgens früh um fünf bis weit nach Mitternacht und lernte von ihr, mit Lieferanten knallhart zu verhandeln und nur die beste Qualität zu akzeptieren. Zum Restaurant Col de la Luère gehörte auch eine kleine Landwirtschaft. Dort musste der Stift Bocuse neben seiner Küchenarbeit unter den Argusaugen der Mutter Brazier lernen, wie man einen Gemüsegarten beackert. Und wie man Kühe melkt.
Die Erfolgsgeschichte von Eugénie Brazier zeigt beispielhaft, wie sich der Aufstieg weiblicher Köche in den Olymp der Sternegastronomie vollzog. Er erfolgte fast ausschließlich auf dem Weg der Popularisierung der bürgerlichen Küche. Nahezu alle Wirtshausköchinnen im Lyon des späten 19. Jahrhunderts, die unter dem Sammelbegriff „Mères Lyonnaises“ berühmt geworden sind, haben als Küchenmädchen in bürgerlichen Haushalten angefangen. Dank der herausragenden Versorgungslage der Stadt Lyon standen ihnen die denkbar besten Grundzutaten zur Verfügung. Damit ließen sich viele ursprünglich rustikal-bäuerliche oder kleinbürgerliche Rezepte aufs Delikateste verfeinern.
Die Kochkunst der Mütter von Lyon machte die bürgerliche Küche salonfähig. Ihre Rezeptinterpretationen wurden zu Klassikern. Pochierte Eier in Burgundersauce, warme Fasanenpastete im Briocheteig, Hechtklößchen und Nierchen in Noïlly Prat symbolisieren den Aufstieg der bürgerlichen Küche der Frauen in die Welt der Künste. Als die ersten Kindeskinder und Schüler der Mütter von Lyon, wie beispielsweise Georges Blanc und Paul Bocuse, zu Sterneköchen aufstiegen, trugen sie das kulinarische Erbe der „Mères Lyonnaises“ in die Sphäre der Spitzengastronomie hinein.
Paul Bocuse betont des Öfteren, dass er bei Eugénie Brazier dazu inspiriert wurde, in der feinen Küche das Herkömmliche mit dem Neuen zu verbinden. Anne-Sophie Pic, die derzeit einzige weibliche Drei-Sterne-Köchin Frankreichs, beruft sich ebenfalls auf das Erbe ihrer Großmutter. Pics Restaurant Maison Pic in Valence ist ein Familienbetrieb, der bereits unter ihren Großeltern Sophie und André Pic, 1945 mit drei Michelinsternen ausgezeichnet wurde. Auch die Kochkunst einer Sterneköchin wie Léa Linster in Luxemburg weist die Handschrift einer verfeinerten, bürgerlichen Küchentradition auf und verleugnet bei aller Individualität nicht die bodenständigen Wurzeln ihrer Herkunft.
Ihre Kollegin Hélène Darroze, Zwei-Sterne-Köchin in Paris, bezeichnet ihren eigenen Kochstil unter Anspielung auf die männlich dominierte Haute Cuisine als „Haute Rustique“. Für Hélène Darroze ist Kochkunst ohne die Kunst der Gastgeberschaft, deren Wesensmerkmale Herzlichkeit und Großzügigkeit sind, nicht denkbar: „Wenn meine Gäste sagen, sie hätten sich in meinem Restaurant wie zu Hause gefühlt, ist das für mich das schönste Kompliment“, sagt sie.
In der weiblichen Spitzenküche wird die Reminiszenz an das „home cooking“, an die unverkünstelte, von keinem verkrampften Ehrgeiz angetriebene mütterliche Küche von einst, häufig als besonderes Merkmal betont. Österreichs Zwei-Sterne-Köchin Johanna Maier hat in ihr Kochbuch ein Rezept für Marmorkuchen aufgenommen, das sie mit den Worten einführt: „von meiner Oma“.
Unternimmt man den Versuch, Wesensmerkmale einer „Cuisine Feminine“ zu definieren, so müsste man die Verbindung von Ernährung und Kunst als das genuine Verdienst der ersten weiblichen Spitzenköche herausstellen. Wenn sich Sterneköche heutzutage auf Regionalität und Bodenständigkeit berufen, so ist dies als eine Hommage an eine Tradition zu bewerten, die - kulturhistorisch besehen – von Köchinnen etabliert wurde. Die ersten weiblichen Spitzenköche wurden verehrt, weil sie die Kunst begründeten, überlieferte, alltägliche Familienrezepte auf eine unnachahmliche, sehr persönliche Weise zu verfeinern.
Bis in die 1970er-Jahre waren Frauen in der Spitzengastronomie Ausnahmeerscheinungen. Das ist wenig verwunderlich, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass bis in die 1970er Jahre hinein die Gesetzeslage vieler Staaten den Frauen die Pflicht auferlegte, die Einwilligung ihrer Ehemänner einzuholen, wenn sie ein Konto eröffnen oder eine berufliche Arbeit aufnehmen wollten. Auffallend viele Köchinnen, die in den 1970er- und 1980er Jahren bekannt wurden, waren Autodidaktinnen.
Elfie Casty, die die Nouvelle Cuisine in der Schweizer Spitzengastronomie einführte und in die exklusive „Association des Restauratrices-Cuisinières de France“ aufgenommen wurde; die Zwei-Sterne-Köchin Lisl Wagner-Bacher in der Wachau bei Wien, die das Erbe der Wiener Küche mit besten regionalen Produkten neu interpretierte und dafür 1983 als erste Österreicherin vom „Gault Millau“ mit dem Titel „Köchin des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Oder auch die Sterneköchin Nadia Santini in der Lombardei – sie alle lernten das Kochen entweder von ihrer Mutter oder Schwiegermutter oder durch Eigeninitiative.
Die Mehrzahl der Köchinnen, die sich in dieser Zeit einen Namen machte, stammt aus Gastwirtsfamilien. Damit stehen diese Frauen in der stolzen Tradition des Dorfwirtshauses, einer für die Kulturgeschichte der Kulinarik bedeutsamen Institution. Die am Herd stehende, die Dorfgemeinschaft bekochende Wirtin ist eine historische Figur von herausragender Bedeutung. Das Wirtshaus, die Taverne, der Bouchon oder der Pub – wie auch immer man diese Einrichtung in den verschiedenen Ländern nennt – ist das älteste kulturhistorische Vorbild der europäischen Restaurantkultur. Das Wirtshaus war eine der wenigen Domänen, in der sich Frauen in früheren Epochen beruflich hervortun durften. Neben der Kirche war das Wirtshaus die Seele eines Dorfes. Und so kam einer Wirtin, die sich um das Wohl der Dorfgemeinschaft kümmerte, der Respekt der ganzen Gemeinde zu.
Es ist kein Zufall, dass aus dieser Tradition auffallend viele der ersten, mit Gault-Millau-Hauben und Michelinsternen dekorierten Chefköchinnen hervorgingen. Auch so bekannte Spitzenköchinnen wie Sissy Sonnleitner in Kärnten, Elena Arzak im baskischen San Sebastián oder Douce Steiner in Deutschland sind Töchter aus gastronomischen Familienbetrieben – und führen dieses Erbe erfolgreich fort.
Solange es Sterneköche wie Paul Bocuse gibt, die mit Sprüchen von sich reden machen wie jenem: „Frauen gehören ins Schlafzimmer, nicht aber in eine Profiküche“, ist die elterliche Restaurantküche nach wie vor für viele kulinarisch ambitionierte junge Frauen ein geschützter Raum, in dem sich ihre Kreativität frei von Ressentiments entfalten kann. Denn noch ist die Misogynie in der internationalen Spitzengastronomie kein Schnee von gestern.
Weiterlesen
Der Text ist ein Auszug aus „Frauen mit Geschmack. Vom Vergnügen, eine gute Köchin zu sein“