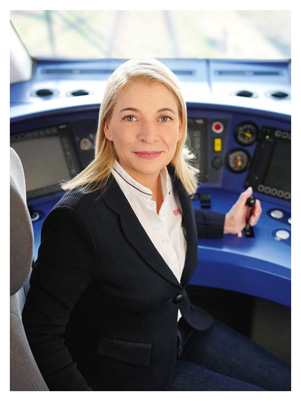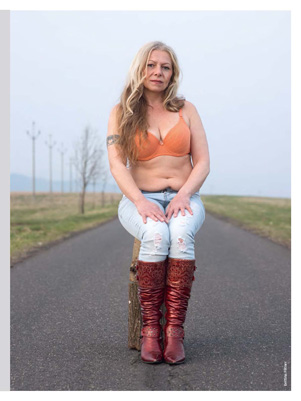P.C. verhindert das freie Denken!
Mit einer Debatte über ihr Buch „The End of Men“ (Das Ende der Männer) hatte Hanna Rosin gerechnet. Auch mit Kritik, sogar mit Verrissen. Die Welle von Häme und persönlichen Anfeindungen, die der amerikanischen Feministin aus den sozialen Netzwerken entgegenschlug, machte sie jedoch sprachlos. Rosins These, Frauen seien den sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen der postindustriellen Gesellschaft eher gewachsen als Männer, interpretierten manche Amerikanerinnen als „Verharmlosung des Sexismus“ – und attackierten die Autorin.
Wer die reine
Lehre twittert,
erntet Zuspruch,
ansonsten gibt's
Einschüchterung!
„Für mich ist Hanna Rosin die Erzfeindin des Feminismus. Sie schadet Frauen aller Klassen, aber besonders denen, die weniger verdienen. Sie ist gefährlich, weil die Leute denken, sie wisse, worüber sie redet“, schrieb eine Anonyma im Internet. „Herablassender Bullshit“, spottete eine andere Anonyme. Und unter dem Hashtag #RIPpatriarchy („Ruhe in Frieden, Patriarchat“) warfen Tausende der bekannten Autorin vor, sich als „gutverdienende Journalistin“ längst von den „vielen weniger Privilegierten entfernt“ zu haben.
Und Rosins Reaktion auf die Vorhaltung, dem politisch korrekten Feminismus den Rücken gekehrt zu haben? Resignation und Rückzug. „Wer die reine Lehre twittert, erntet eine Welle von Zuneigung und positiven Bewertungen. Wer aber feministische Zwischentöne anschlägt, wird vom Gegenteil eingeholt. Der Preis ist zu hoch“, klagte die Gründerin der Rubrik "Factor" auf der Website Slate.com im New York Magazine.
Die 45-jährige Rosin ist nicht die Einzige, die heutzutage im Namen der Political Correctness niedergebrüllt wird. Besonders an amerikanischen Universitäten und in sozialen Netzwerken erfährt das Dogma der frühen 1990er, das „zum Schutz nicht privilegierter gesellschaftlicher Gruppen“ eine codierte Sprache und „nicht verletzendes Handeln“ fordert, ein durchschlagendes Comeback.
Dass die VerfechterInnen der politischen Korrektheit dabei jeden Diskurs schon im Keim ersticken zu Themen wie Geschlechter, Ethnie oder Religion, betrachten viele mit Sorge. „In den sozialen Medien bringen sich ganze Armeen unbezahlter, aber vielgelesener Kommentatoren in Stellung, um bei dem kleinsten identitätspolitischen Fehltritt Hashtag-Kampagnen zu starten oder Online-Petitionen herumgehen zu lassen“, beschreibt die New Yorkerin Rebecca Traister das Phänomen der Political Correctness im digitalen Zeitalter.
Da in den sozialen Medien provokante Thesen zunehmend mit feindseligen Posts bestraft werden, werden die VerfechterInnen neuer bzw. anderer Ideen in die Isolation getrieben. „Ich hatte das Gefühl, allein gegen Millionen zu stehen“, erinnerte sich Hanna Rosin an die Wochen nach der Veröffentlichung ihres Buches.
Auch die Universitäten, die eigentlich ein Hort des freien Denkens sein sollten, leiden zunehmend unter den Exzessen der politischen Korrektheit. So feuerte im vergangenen Sommer die Louisiana State University (LSU) die Professorin Teresa Buchanan, weil sie in ihren Seminaren mehrfach „Fuck no!“ gesagt hatte (das sei „sexuell unterlegt“!) und sich ironisch über den Sex in langjährigen Beziehungen äußerte.
Für den Aus-
spruch "Fuck no!" wurde eine
Professorin
entlassen
Die Universitätsleitung wertete Buchanans Umgangston als „sexuelle Belästigung“. Die Pädagogik-Professorin argumentierte, für sie sei das umgangssprachliche „Fuck no!“ nur eine Art gewesen, müde SeminarteilnehmerInnen wachzurütteln. Sie argumentierte: „Schimpfwörter sind keine sexuelle Belästigung. Auch offene Diskussionen über Themen, die mit Sexualität zu tun haben, nicht. Schon gar nicht, wenn es dabei um die Vermittlung von Wissen über die sexuelle Realität geht“.
Obwohl zahlreiche ProfessorInnen der Fakultät die Reaktion der Louisiana State University als überzogen verurteilten, musste die Professorin ihren Lehrstuhl am Baton Rouge räumen, nach 20 Jahren.
Bei vielen AmerikanerInnen rufen die Hexenjagden Erinnerungen an die frühen 1990er Jahre wach. Damals hatte die New York Times als erste den Trend vieler Universitäten zwischen New York und Los Angeles registriert, StudentInnen ein fest umrissenes Weltbild zu vermitteln. Neben Literatur, Geschichte und Naturwissenschaften waren eine Art Bildungspakete zu Gender, Rasse, Ökologie oder Außenpolitik erarbeitet worden, die dem akademischen Nachwuchs eine „korrekte“ Sicht der Dinge mit auf den Weg geben sollten.
Schon damals hatten ProfessorInnen und JournalistInnen vor der Gefahr gewarnt, dass durch die Political Correctness (P.C.) und ihre Dogmen jegliche gesellschaftspolitische Debatte erstickt würde. Was nicht nur Konservative verschreckte, sondern auch die 68er. „Manche nennen es liberalen Faschismus“, spottete der Kunstkritiker Roger Kimball. Der Druck, das eigene Denken anzupassen, um nicht als politisch unkorrekt gebrandmarkt zu werden, ersticke jede Diskussion. „Im Namen von Pluralismus und Meinungsfreiheit wird versucht, eine enge und politisch motivierte Sicht auf die Lehrinhalte der Universitäten zu übertragen. Dabei wird vorgeschrieben, was ein gebildeter Mensch, ein verantwortungsbewusster Bürger zu denken habe“, monierte der Verfasser des Buches „Tenured Radicals“ (etwa: Radikale Lehrstuhlinhaber).
Hinter neuen
Begriffen ver-
bergen sich
nur die alten Dogmen
Die nun wieder frisch befeuerte Political Correctness erreichte jetzt auch die State University of New York, mit mehr als 460.000 Studierenden eines der größten Universitätssysteme der Vereinigten Staaten. Nach dem Vorbild von Facebook, das vor zwei Jahren mehr als 50 unterschiedliche Geschlechtsidentitäten einführte, kündigte die Universität sieben unterschiedliche Gender-Rubriken an, darunter auch „Genderqueer“ und „Suchend“. KritikerInnen monieren die Unverhältnismäßigkeit, da etwa 99,7 Prozent aller Menschen „Cisgender“ seien, also bei ihnen die Geschlechtsidentität und Geburtsgeschlecht übereinstimmten. Die Phantasiepronomen für die verbleibenden 0,3 Prozent könnten unter Umständen zu neuen Vorwürfen der sexuellen Belästigung führen, argumentieren sie, wenn zum Beispiel ein Professor die gewählte Identität eines Studierenden vergesse oder verwechsele.
Viele ProfessorInnen bewegen sich seit Jahren wie auf Eiern, um StudentInnen nicht zu brüskieren. An immer mehr Universitäten schicken sie ihren Seminartexten inzwischen Warnhinweise („Trigger warnings“) voraus, die Kursteilnehmer auf eventuell „verstörendes Vokabular“ vorbereiten sollen. Hinzu kommt die Gefahr so genannter „Mikroaggressionen“, also unbeabsichtigter Kränkungen. „Hinter diese neuen, modernen Begriffen verbergen sich lediglich die alten Dogmen der P.C.-Bewegung der 90er: Dass die Leute selbst die kleinste beunruhigende Idee oder das kleinste beunruhigende Verhalten als Großoffensive werten“, klagte der liberale Journalist Jonathan Chait. Bildung als Austausch von Gedanken und Positionen fände nicht mehr statt, kulturelles Leben erstarre.
Chait verwies als Beispiel auf die Theatergruppe des Mount Holyoke College in Massachusetts, die „Die Vagina-Monologe“ von Eve Ensler aus dem Programm gestrichen hatte. Grund: Das Stück schließe „Frauen ohne Vagina“ aus, also Transsexuelle. „Leider ist das keine Ausnahme“, klagt Chait.
Schließen die
Vagina-Monologe
Frauen ohne
Vagina aus?
Gastrednerinnen wie Christine Lagarde oder Condoleezza Rice sagten nach heftigen Studentenprotesten ihre Besuche an renommierten Universitäten neuerdings schon im Vorhinein wieder ab. So lehnte die Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, eine Einladung des Smith College ab, nachdem StudentInnen ihr als Repräsentantin des IWF die „Unterdrückung und den Missbrauch von Frauen weltweit“ vorgeworfen hatten. Die frühere amerikanische Außenministerin Condolezza Rice verzichtete auf den geplanten Besuch der Rutgers University, nachdem sie der Menschenrechtsverletzungen während des Irak-Krieges bezichtigt worden war. Anstelle eines durchaus denkbaren kontroversen Diskurses hatten die StudentInnen also schon die bloße Einladung von Rice abgelehnt.
An der University of Chicago machte sich danach hörbar Unmut breit. Universitätspräsident Robert Zimmer gründete ein „Komitee zur Meinungsfreiheit“, das versuchte, einen „Leitfaden für den Bildungsauftrag“ zu entwickeln. „Es ist nicht Aufgabe der Universität, Personen vor Ideen und Meinungen zu schützen, die in ihren Augen unerwünscht, widerwärtig oder auch zutiefst anstößig sind“, argumentierte das Komitee im Sommer 2014. Das „Chicago Statement“, eine Absage an die Auswüchse der politischen Korrektheit, wurde inzwischen auch von anderen Universitäten, wie Princeton und Purdue, übernommen.
Selbst Präsident Barack Obama, der vor dem Einzug in das Weiße Haus Verfassungsrecht an der University of Chicago gelehrt hatte, sprang den Kritikern der Political Correctness unerwartet offensiv zur Seite. „Einige Universitäten lehnen Bücher mit Beleidigungen gegen Afroamerikaner oder abfälligen Signalen gegen Frauen ab. Davon halte ich nichts“, ließ Obama die StudentInnen wissen. „Menschen lernen nicht, wenn sie verhätschelt und vor anderen Sichtweisen abgeschirmt werden.“
Über all dem, versteht sich, ist von „Frauen“ quasi gar nicht mehr die Rede.
Christiane Heil
Der hier gekürzte Text steht in der Mai/Juni Ausgabe 2016. Ausgabe bestellen