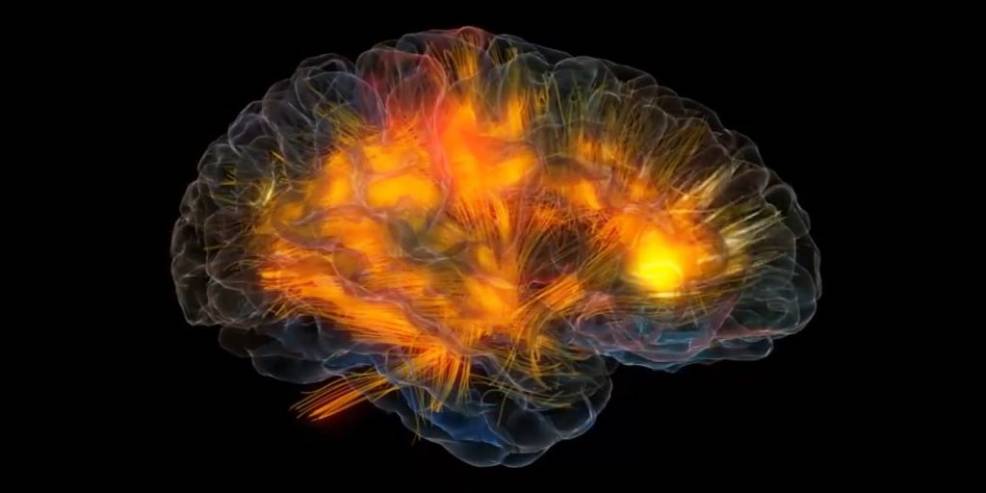Die Zeichen stehen auf Gleichheit
Daphna Joel wollte es genau wissen: Kann man die Gehirne von Männern und Frauen wirklich an ihrer Form unterscheiden? Oder ist das nur ein pseudowissenschaftliches Vorurteil?
Die Psychobiologin von der Universität Tel Aviv nahm sich deshalb zusammen mit KollegInnen aus Zürich und Leipzig die Datensätze der Hirnscans vor, insgesamt von 1.400 Männern und Frauen. Das Team beschloss zu prüfen, ob es im Gehirn Strukturen gibt, die sich bei Mann und Frau unterscheiden wie die Geschlechtsorgane – also klar „dimorph“ sind.
In der Vergangenheit wurden nämlich immer wieder mehr oder weniger geringe Strukturdifferenzen beschrieben, etwa ein größerer „präoptischer Nukleus“ beim Mann und ein dickerer „Balken“ zwischen den beiden Hirnhälften bei der Frau. Es sind diese Unterschiede, auf denen Wissenschaftler und Buchautoren, die von naturgegebenen Geschlechtsunterschieden überzeugt sind, ganze Weltbilder errichten: „Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus“ – wir kennen das.
Dabei wissen Hirnanatomen eigentlich schon lange, dass es so gut wie unmöglich ist, ein isoliertes männliches Gehirn von einem weiblichen zu unterscheiden. Denn die wenigen anatomischen Unterschiede, die man gefunden hat, sind statistischer Natur. So ist zum Beispiel der „präoptische Nukleus“, ein Kerngebiet im Hypothalamus, bei Männern im Durchschnitt doppelt so groß wie bei Frauen. Aber weil die Schwankungsbreite groß ist, ist er gleichzeitig bei einem Drittel der Männer so klein wie in einem typischen Frauengehirn. Da läge die Anatomin also daneben, wenn sie tippen würde: typisch Frau.
Joel und KollegInnen haben 116 Hirnregionen vermessen. Und sie stellten im Jahr 2015 fest: Selbst wenn man viele Regionen eines einzelnen Gehirns daraufhin prüft, ob sie eher männlich oder weiblich geformt sind, kommt man nicht zu einem sicheren Ergebnis. Denn es gibt keine Konsistenz: Ein Gehirn, das in Region A am „weiblichen“ Rand der statistischen Verteilung liegt, liegt in Region B möglicherweise am „männlichen“ Ende.
Menschliche Gehirne sind also individuelle Mosaike von so genannter „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ – die Idee, es gäbe ein Frauengehirn und ein Männergehirn, ist damit obsolet. Das hat Konsequenzen für die Forschung: In einem Text für die Royal Society, die altehrwürdige Wissenschaftsakademie von Großbritannien, plädieren Daphna Joel und die amerikanische Biologin und Gender-Forscherin Anne Fausto-Sterling gemeinsam dafür, künftig bei Studien zur Funktion gesunder Gehirne die Kategorie Geschlecht gar nicht mehr als erklärende Variable zu benutzen. „Gehirne von Frauen mit den Gehirnen von Männern zu vergleichen, wäre nämlich so, als würde man zwei Zufallsgruppen von Gehirnen aus derselben Population vergleichen“ – also unnötig und womöglich irreführend.
Nur wenn es um Krankheiten des Gehirns gehe, argumentieren die Wissenschaftlerinnen, könnte es sinnvoll sein, einen Geschlechtereinfluss zu prüfen. Denn es ist bekannt, dass bestimmte neurologische und psychiatrische Störungen ungleich verteilt sind: So gibt es unter Männern mehr Autisten und Schizophrenie-Betroffene als unter Frauen, dafür leiden Frauen beispielsweise häufiger unter Schmerzen. Es ist noch zu klären, ob die Ursachen dafür biologische oder soziale sind.
Der britische Neuropsychologe Simon Baron-Cohen glaubt allerdings, die Antwort schon zu haben. Seine These: Geschlechtshormone, die während der Gehirnentwicklung unterschiedlich auf Jungen- und Mädchengehirne einwirken, hinterlassen unwiderrufliche Spuren – im Sinne einer höheren Empathie bei der Frau („E-Gehirn“) und einem Hang zum Systematisieren beim Mann („S-Gehirn“). Ein extrem männlich geprägtes Gehirn werde deshalb anfällig für Autismus, meint Baron-Cohen – eine Störung, für die ein rigider Ordnungssinn, gepaart mit sozialen Defiziten, typisch ist. In seinem Buch „Vom ersten Tag an anders – das weibliche und das männliche Gehirn“ hat der Engländer diese Ideen vor einigen Jahren publikumswirksam aufbereitet.
Doch ist da etwas dran? Nicht, wenn man Christine Zunke von der Universität Oldenburg fragt. Sie hat das Buch mit dem skeptischen Blick der kritischen Naturphilosophin gelesen und findet, dass hier „ideologischer Irrsinn zur wissenschaftlichen Tatsache“ aufgeblasen wird. Baron-Cohen argumentiere im Kreis herum, bemängelt sie: Er schließt von geschlechtstypischem Verhalten auf materielle Unterschiede im Gehirn und erklärt aus diesen wieder Unterschiede im Verhalten. Letztlich bleiben seine Thesen spekulativ und unbewiesen.
Mit ähnlich unzureichendem wissenschaftlichem Rüstzeug wie der Engländer Baron-Cohen gehen die Neuropsychiater Raquel und Ruben Gur von der Universität Pennsylvania in den USA zu Werke. In einer 2014 publizierten Studie vermaßen sie die Verbindungswege in den Gehirnen von 949 Jugendlichen, 428 Jungen und 521 Mädchen.
Das bildgebende Verfahren, das dabei zum Einsatz kam, ist neueste Spitzentechnologie: Diffusions-Tensor-Bildgebung nennt es sich und produziert wunderschöne Bilder von bunten Fasern im Gehirn. Doch schon der erste Satz der Veröffentlichung verrät das gestrige Denken, das dahintersteckt.
„Geschlechtsunterschiede im menschlichen Verhalten sind auf angepasste Weise komplementär: Männer haben bessere motorische und räumliche Fähigkeiten, wohingegen Frauen ein besseres Gedächtnis haben und im sozialen Denken besser sind“, behaupten diese Wissenschaftler. Kein Wunder, dass das Ehepaar Gur in den bunten Fasern der Hirnbilder angebliche Erklärungen für diese evolutionär so vorteilhaften („angepassten“) Unterschiede dann auch findet.
Unterschiede, die es so gar nicht gibt, wie Fachleute wissen. Der Neurowissenschaftlerin Cordelia Fine jedenfalls platzte der Kragen, als sie sah, wie die Erzieherin im Kindergarten ihres Sohnes ein Buch las, in dem behauptet wird, Jungengehirne seien nicht in der Lage, eine Verbindung zwischen Gefühl und Sprache herzustellen. Diese Art von „Neurosexismus“ begünstige „schädliche, diskriminierende, potentiell sich selbst erfüllende Stereotype“, befand die verärgerte Mutter – und beschloss, selbst ein Buch zu schreiben.
„Die Geschlechterlüge“ heißt ihr Buch, Untertitel: „Die Macht der Vorurteile über Frau und Mann“. Darin nimmt Fine die populären Bestseller über den angeblich großen Unterschied zwischen Mann und Frau auseinander (à la „Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken“) – und deckt ganz nebenbei auch bei prominenten HirnforscherInnen Denkfehler und ideologische Voreingenommenheit auf.
Cordelia Fine ist nicht irgendwer. Die 1975 in England geborene Tochter einer Schriftstellerin hat Psychologie und Neurowissenschaft studiert und ist Professorin für Betriebspsychologie im australischen Melbourne. Ihr Buch liest sich hervorragend, ihre Analysen sind fundiert und verständlich, ihre Polemik ist erfrischend.
Leider hat Fines 2010 auf Englisch und 2012 auf Deutsch erschienenes Buch nie die Auflagen der von ihr kompetent zerlegten Werke erreicht (Die deutsche Ausgabe ist momentan sogar vergriffen). Dabei wäre „Die Geschlechterlüge“ als Standardlektüre für Gender-Seminare ideal. Denn sie belegt, dass die Gemeinsamkeiten der Geschlechter viel größer sind als die Unterschiede.
2005 hatte die Psychologin Janet Shibley Hyde den Anfang gemacht. In der Fachzeitschrift American Psychologist stellte sie ihre Hypothese der Geschlechterähnlichkeit („The Gender Similarities Hypothesis“) zur Diskussion und belegte sie mit großen Metastudien. Metastudien entstehen, wenn WissenschaftlerInnen die Daten mehrerer Einzelstudien zum selben Thema zusammenwerfen und sie statistisch neu analysieren.
Janet Hyde ist Expertin für solche Auswertungen – gerade wenn es um das Ausmaß von Geschlechterunterschieden geht. Sie hat schon in den 1980er Jahren dazu publiziert. Weil sie beobachtet hatte, dass sich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen immer mehr einebnen, postulierte sie 2005, dass „Männer und Frauen einander bei den meisten, wenn auch nicht allen psychologischen Variablen ähnlich sind. Das bedeutet: Männer und Frauen, Jungen und Mädchen gleichen sich mehr als sie sich unterscheiden.“ Das ist im Kern die Hypothese der Geschlechterähnlichkeit.
Hyde fand bei 128 Variablen – von Rechenfähigkeit bis Lebenszufriedenheit, von Hilfsbereitschaft bis zur Neigung zum Tricksen – in mehr als drei Viertel der Fälle quasi keine Unterschiede. Sie fand nur ein paar Ausnahmen, bei denen mittlere oder gar große Unterschiede sichtbar wurden: und zwar in Bezug auf die Einstellungen zur Sexualität und Gewalt sowie bei motorischen Fähigkeiten wie Werfen. Also bei nicht wirklich geistigen Leistungen, sondern eher bei sozialen und körperlichen Eigenschaften.
Liegen diese Unterschiede nun an der Biologie oder an der Umwelt? Über die Gründe ist noch gar nichts gesagt, weil es in der Studie nur um das Ausmaß der Unterschiede ging. Aber bei den Bereichen „Sexualität“ und „Gewalt“ ist, wie wir wissen, der psychosoziale Einfluss sehr stark. Hydes Arbeit fand starke Verbreitung. Sie wird heute sogar auch in wissenschaftlichen Veröffentlichungen zitiert, die die Geschlechtsunterschiede eher betonen.
2013 machten der Psychologe Harry T. Reis und seine damalige Doktorandin Bobbi J. Carothers den nächsten Schritt: Sie warfen die Daten von 13.000 ProbandInnen aus 13 psychologischen Studien zusammen und untersuchten mit statistischen Methoden, ob die darin gefundenen Geschlechtsunterschiede eher kategorischer Natur sind, also wie schwarz und weiß, oder eher dimensional, also wie Grauschattierungen auf einer Skala.
Wer von einem männlichen und einem weiblichen Hirntyp ausgeht, so die Argumentation der WissenschaftlerInnen, müsste dies mit Daten belegen können, die klar in zwei Kategorien auseinanderfallen. Bei der Körpergröße von Männern und Frauen ist das der Fall: Auch wenn sich die Maße überschneiden, gibt es zwei Gruppen mit unterschiedlichen Mittelwerten. Bei den Größten ist dann auch zu erwarten, dass sie die Stärksten sind – und dass sie Männer sind.
Wie ist es aber mit psychologischen Variablen wie Empathie oder Persönlichkeitseigenschaften wie Extraversion oder Gewissenhaftigkeit? Zerfallen auch die in zwei Gruppen? Reis und Carothers analysierten ihre Daten mit mehreren Verfahren hin und her – aber so gut wie immer fanden sie nur dimensionale, also graduelle Unterschiede.
Dies gilt beispielsweise auch für eine Eigenschaft mit so hartnäckiger Geschlechterzuweisung wie das Interesse für Wissenschaft und Technik. Die variiert auf einer Skala, an deren einem Ende sich mehr Männer finden und am anderen mehr Frauen. Aber es gibt nicht den geringsten Hinweis darauf, dass etwa eine in Sachen Empathie oder Fürsorglichkeit sehr weibliche Person sich nicht für Wissenschaft interessiert (oder gar schlechter einparken kann).
„Männer und Frauen sind von der Erde“, lautete das Fazit der beiden PsychologInnen. Bleibt noch zu ergänzen, dass Bobbi Carothers inzwischen den sehr angesagten „männlichen“ Beruf einer Datenanalytikerin ausübt, und zwar in der Gesundheitsforschung.
Vorurteilsfreie Forschung ist schwierig, egal ob es um die Natur- oder die Sozialwissenschaften geht. Das weiß auch Cordelia Fine. Oft sei es Denkfaulheit, gibt sie zu bedenken, wenn für einen Unterschied, der sich gesellschaftlich schwer erklären oder gar beseitigen lässt, die Biologie als Ursache aus dem Hut gezaubert wird.
Doch langfristig gesehen stehen die Zeichen auf Gleichheit der Geschlechter. Und wie man an Daphna Joels Anatomie-Studie sehen kann, kommen die Argumente dafür neuerdings sogar aus der Biologie – jener Wissenschaft, die so lange dafür herhalten musste, Männern und Frauen ihren angeblich „natürlichen“ Platz zuzuweisen.
Judith Rauch